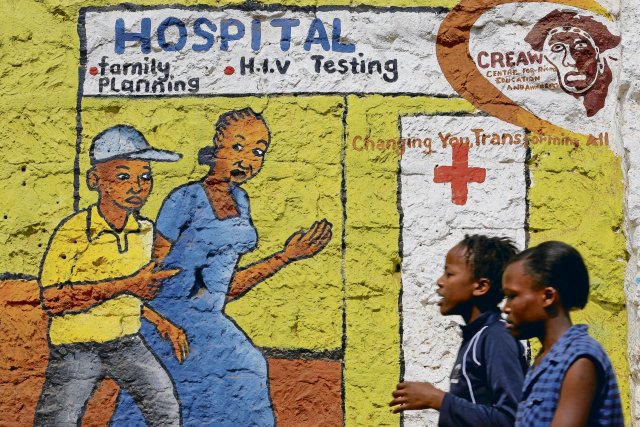- Wirtschaft und Umwelt
- Gründe für Wohnungslosigkeit
Entlassen, verschuldet, zwangsgeräumt
Die Idee des Wohnraums für alle scheitert an »mittelalterlichen Methoden«

Paragraf 67 des deutschen Sozialgesetzbuches garantiert die Unterbringung mit dem Ziel eines eigenverantwortlichen Lebens. Paragraf 16 des Berliner Sicherheits- und Ordnungsrechts bietet die Möglichkeit, Wohnraum bei drohender Obdachlosigkeit zu beschlagnahmen. Und Paragraf 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verlangt nach der Bereitstellung menschenwürdigen Wohnraums bei einer Zwangsräumung. Wenn Daniel Zaibi seine Geschichte erzählt, fließen unzählige Paragrafen in den Bericht ein. Schließlich ist er inzwischen Experte auf dem Gebiet Wohnungslosigkeit – durch seine eigene Situation und seine Arbeit in Kollektiven wie dem Netzwerk Wohnungsloser Menschen Wohnungslosen_Stiftung.
Zaibi lebte 36 Jahre in derselben Wohnung in Berlin, bis er aufgrund von Vernachlässigung und ausbleibender Reparaturen seine Miete minderte, also weniger zahlte, erzählt er. Das wurde ihm als Mietschulden ausgelegt, nach 12 Jahren folgten ein Rechtsstreit, eine Zwangsräumung und sechs Jahre Wohnungslosigkeit. Dazu führten laut Zaibi viele Gründe: Schlechte Beratung durch seinen Anwalt, unzureichende Unterstützung durch zuständige Behörden, Profitinteressen der Vermieter: »Früher war mein Wohnort ein Arbeiterviertel, inzwischen sind die Mieten dort sehr hoch.«
Wirft man einen Blick in Statistiken wie den Wohnungslosenbericht der Bundesregierung oder die Berichte der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W), die Einrichtungen für Menschen in Wohnungslosigkeit vertritt, so bleiben die häufigsten Auslöser für Wohnungslosigkeit seit Jahren Zwangsräumungen, begründet mit Miet- und Energieschulden. Das hat strukturelle Ursachen. Seit über zehn Jahren steigen Wohnkosten in Ballungsräumen schneller als Durchschnittseinkommen und die Zahl der Sozialwohnungen sinkt. Ende 2024 gab es bundesweit nur noch rund 1,05 Millionen öffentlich geförderte Wohnungen – ein historischer Tiefstand. Diametral dazu steigt die Zahl der Wohnungslosen. Sie lag 2024 bei über einer halben Million Menschen. Die Dunkelziffer dürfte höher sein.
»Ich war viele Jahre Schlosser, hatte eine kleine Wohnung und habe mir nie Gedanken gemacht, dass ich mal wohnungslos werden könnte. Dann kam erst die Krankheit, dann die Kündigung. Als das Krankengeld auslief, blieb die Miete offen, und die Wohnung war weg. Das Amt half zwar bei der Notunterkunft, aber keine Vermieterin wollte mich mehr. Es hätte anders laufen müssen – früher Unterstützung, weniger Bürokratie. Heute lebe ich in einer Gemeinschaftsunterkunft. Ich engagiere mich im Verein, damit andere diesen Absturz nicht allein erleben müssen.«
Thomas (54) Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e.V.
Etwa 300 Kilometer entfernt von Zaibi sitzt Swen Huchatz, ebenfalls bei der Wohnungslosen_Stiftung aktiv, in seiner Wohnung in Hildesheim in Niedersachsen. »Eine Luxus-Wohnung« freut er sich über seine 60-Quadratmeter und zeigt auf ein buntes Sofa. »Das hat fast sechs Quadratmeter Fläche.« Huchatz war ab Anfang der 2000er über 20 Jahre lang obdach- und wohnungslos, arbeitete in der Saisonarbeit, in der Ernte oder auf dem Bau. Wohnungslose haben keinen sicheren Wohnort, manche kommen bei Bekannten oder in Notunterkünften unter. Obdachlose leben auf der Straße.
Was der konkrete Auslöser für seine Wohnungsnot war, kann Huchatz heute nicht mehr so genau sagen, meint er. Er kam aus einem »schwierigen Umfeld«, geprägt von wechselnden Familienstrukturen und Gewalt. Er hatte das Gefühl, da »weg zu müssen«. »Irgendwann wurden aus dem Weglaufen Jahre«. Doch heute sei die Situation auf dem Wohnungsmarkt viel dramatischer als damals.
»In der Wohnungslosenhilfe kommt es derzeit zu quantitativen und qualitativen Veränderungen: Vor dem Hintergrund des fehlenden leistbaren Wohnraums sind immer mehr Menschen in Wohnungsnot und verbleiben länger im Hilfesystem«, beschreibt es Frank Sowa, Soziologieprofessor mit Schwerpunkt auf Wohnungslosigkeit von der Technischen Hochschule Nürnberg. »Zudem befinden sich Nutzer*innen in immer komplexeren Lebens- und Problemlagen«. Mit »Nutzer*innen« meint Sowa Personen, die Hilfssysteme in Anspruch nehmen.
»Nach meiner Trennung stand ich plötzlich allein mit allem da. Erst dachte ich, ich finde schnell wieder etwas – aber die Preise sind explodiert. Mit Teilzeitgehalt und Schulden wegen alter Stromrechnungen hatte ich keine Chance. Was hätte anders sein müssen? Mehr sozialer Wohnraum, echte Hilfe bei Schulden, statt nur Papierkram. Heute wohne ich in einem betreuten Projekt und mache wieder kleine Schritte in Richtung Normalität. Ich wünsche mir, dass niemand mehr das Gefühl haben muss, unsichtbar zu sein.«
Marion (48) Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e.V.
Immer mehr psychisch erkrankte obdachlose Personen würden »durch alle Systeme rutschen und in der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe landen«, beispielsweise in der ordnungsrechtlichen Unterbringung oder in Wärmestuben. In Unterkünften, die nicht darauf ausgerichtet sind, häufen sich inzwischen Erzählungen von Personen, die dort mehrere Jahre zubringen, weil sie keine Wohnung finden. Auch Zaibi lebte nach seiner Zwangsräumung viereinhalb Jahre lang auf siebeneinhalb Quadratmetern in einem Wohnheim, mit Gemeinschaftsbad und -küche – für 1300 Euro im Monat.
Innerhalb von zwei Jahren hatte er sich um 3000 Wohnungen beworben, zu 60 Besichtigungen sei er eingeladen worden. »Man fällt in ein noch tieferes Loch als das auf dem Weg bis zur Zwangsräumung«, erinnert er sich. Bei ihm hätte die Zeit Stress, Depressionen, eine Belastungsstörung und Parodontitis ausgelöst. »Die derzeitigen Strukturen führen dazu, dass wohnungslose Menschen sich bei der Bewerbung um Wohnraum ganz hinten anstellen müssen«, ordnet Sowa ein. Forschungen zeigen, dass sie auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert und ausgeschlossen werden.
Der Anstieg der Wohnungslosigkeit erklärt sich auch über die Zunahme der Personen in Wohnungsnot ohne deutsche Staatsangehörigkeit, wie ein kürzlich erschienener Bericht der BAG W zeigt. Wohnungs- und Arbeitslosigkeit verstärken sich gegenseitig. Zusätzliche Barrieren wie ausländische Qualifikationen, die nicht anerkannt werden, führen zu prekären oder irregulären Beschäftigungsverhältnissen, mitunter auch zu Arbeitslosigkeit. Das erschwert die Wohnungssuche.
Umgekehrt beeinflusst die Wohnsituation die Aussichten auf einen Arbeitsplatz. Hinzu kommt eine Polarisierung der Debatte. Es sei spürbar, wie Menschen mit und ohne Staatsbürgerschaft, mit und ohne Wohnung und mit und ohne Erwerbsarbeit verstärkt gegeneinander ausgespielt würden, erklärt Huchatz.
»Ich war nie ›arbeitslos‹, aber ohne Wohnung schon oft. Ich habe als Zeitarbeiter gearbeitet, im Lager, auf dem Bau. Mit befristeten Verträgen und ohne festen Wohnsitz war das wie ein Teufelskreis. Keine Wohnung ohne Arbeit – keine Arbeit ohne Adresse. Was anders sein müsste? Ein faires Mietrecht und Arbeitgeber, die nicht weggucken. Heute schlafe ich in einem kleinen Zelt, aber ich habe wieder Perspektive. Der Verein gibt mir Halt – wie eine zweite Familie.«
Jens (35) Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e.V.
Innerhalb Europas ist Finnland das einzige Land, das seine Obdachlosigkeit seit Einführung eines Grundrechts auf Wohnen und »Housing First« von 2008 bis 2022 mehr als halbieren konnte. Das liegt unter anderem an der Kontinuität der finnischen Wohnpolitik. »Housing First« bedeutet, Menschen in dauerhaften Wohnraum zu vermitteln und davon ausgehend sozialarbeiterisch, therapeutisch und psychologisch zu unterstützen.
Das Konzept ist ein Teil der Lissabonner Erklärung von 2021 mit dem Ziel, Obdachlosigkeit in der EU bis 2030 zu überwinden. »Gleichzeitig sollte es immer unterschiedliche Maßnahmen geben, da nicht für alle Menschen Housing First die Lösung ist«, ergänzt Sowa. Es gebe derzeit eine »Funktionsstörung des Hilfesystems« in Deutschland. Sie könne »nur aufgehoben werden, wenn der Wohnraum geschaffen wird.«
Zaibi wohnt heute auf 38 Quadratmetern und spürt, wie er langsam seinen »geistigen Freiraum« zurückerlangt, sagt er. Sicherheit hat er dort aber immer noch nicht. Von Behörden ist er enttäuscht, »aber die solidarische Unterstützung der Initiativen, die war gut«. Deshalb ist er davon überzeugt, dass es besonders wichtig sei, sich durch gegenseitige Hilfe zur Selbsthilfe zu emanzipieren. Auch Huchatz veränderte seine Situation, nachdem er 2020 in Kontakt mit der Selbstorganisation Wohnungsloser kam. »Es macht keinen Sinn, mit mittelalterlichen Methoden das Wohnen der Zukunft zu organisieren«, sagt er. Deshalb brauche es neue Konzepte anstelle von »teuren Ersatzprojekten« und »unzähligen Paragrafen«.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.