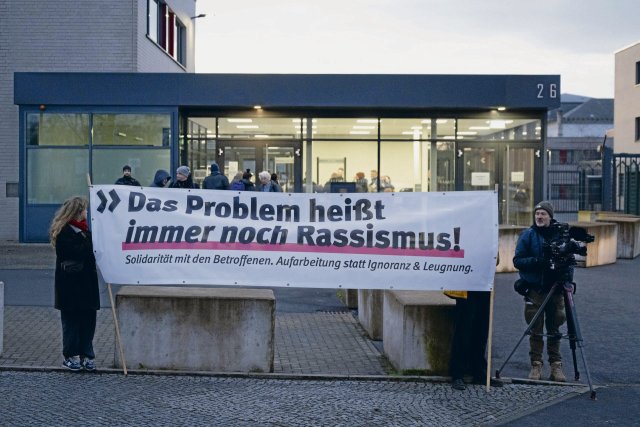- Politik
- Erste Premierministerin in Japan
Takaichi rückt Japan weiter nach rechts
Die erste Frau als Premierministerin hat im Parlament keine eigene Mehrheit

Zweimal war Sanae Takaichi auf dem Weg nach ganz oben schon gescheitert. Und auch beim dritten Anlauf schien es plötzlich so, als würde es wieder nicht klappen. Anfang Oktober hatte die in Japan historisch übermächtige konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) die 64-jährige zur Vorsitzenden gewählt. Dann aber kündigte die zentristisch-buddhistische Partei Komeito eine langjährige Koalition mit der LDP auf. Die Karten wurden neu gemischt. Würde es wieder nichts mit der ersten Frau als Premierministerin?
Seit Dienstag ist klar: Es wurde etwas. Nach mehreren Wahlgängen machten die zwei Kammern des Parlaments Sanae Takaichi schließlich zur neuen Regierungschefin. Japan, das in internationalen Vergleichen zur Geschlechtergleichstellung immer wieder schlecht abschneidet, wird nun von einer Frau regiert. Die Protagonistin aber will sich darauf nicht konzentrieren. Statt vom Beginn der Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen, rief Takaichi zuletzt immer wieder: »Japan ist zurück!« Zurück wohin?
Takaichi gegen Homo-Ehe und weibliche Kaiserin
Tatsächlich ist die Beförderung der Personalie Takaichi ins Amt der Premierministerin längst nicht nur wegen ihres Frauseins ein historischer Schritt. Zumal sie in mehreren gesellschaftspolitischen Fragen – sie ist gegen die Homo-Ehe, gegen die Möglichkeit einer weiblichen Kaiserin und für die Pflicht, dass Ehepaare einen gemeinsamen Nachnamen führen – streng konservativ ist.
Vielmehr wird Takaichi versuchen, Japan nach Jahren gesellschafts- und migrationspolitischer Öffnung weiter nach rechts zu führen. Sie ist bekannt als Nationalistin, die Japans Kriegsvergangenheit – das Land kolonisierte unter anderem Teile Chinas und Korea, griff im Zweiten Weltkrieg diverse Staaten im Pazifik an – immer wieder verharmlost hat. Gegen Menschen aus dem Ausland hat sie wiederholt gestichelt. In Migrationsfragen hat sie versprochen, streng zu sein.
Regierungspartei ist desorientiert
So steht Takaichi dieser Tage für eine Trendwende, wenngleich diese bald schon wie ein Zickzackkurs aussehen könnte. Denn ihre LDP, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs fast immer die Regierung gestellt hat, ist desorientiert. Nach zahlreichen Skandalen wegen Korruption, Vetternwirtschaft und Parteispenden verlor sie unter Premier Shigeru Ishiba innerhalb der vergangenen zwölf Monate sowohl im Unter- als auch im Oberhaus ihre Mehrheit. Ishiba trat nach einem knappen Jahr der Minderheitenregierung zuletzt ab.
Während Ishiba in seiner Partei eher als Liberaler gilt, steht Takaichi für den rechten Flügel der LDP, dem viele Entwicklungen der vergangenen Jahre zu weit gingen. Und nachdem die zentristische Partei Komeito die Koalition aufgekündigt hatte, schloss Takaichi kurzerhand ein Abkommen mit der rechtspopulistischen Partei Nippon Ishin no Kai, deren Name sich mit Innovationspartei Japans (IJP) übersetzen lässt. Die IJP fordert unter anderem eine Obergrenze für die Zahl der Menschen aus dem Ausland.
Xenophobie wieder auf dem Vormarsch
Der Umgang mit Ausländern ist zum Lieblingsthema von Parteien rechts der Mitte geworden, von denen zuletzt mehrere populär wurden. Zwar ist Japan ökonomisch auf Migration angewiesen, wenn es den Trend alterungsbedingten Schrumpfens aufhalten und Wirtschaftswachstum generieren will. Doch im Zuge der Korruptionsskandale und wegen steigender Lebenshaltungskosten konnten populistische Parteien punkten, indem sie Ausländer zu Schuldigen für vermeintliche Kriminalität und Sozialbetrug erklärten.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
In vergangenen Jahrzehnten war auch aus der LDP immer wieder latente Xenophobie wahrzunehmen. In den vergangenen Jahren aber hatte sich die Partei vorsichtig für Migration und Diversität geöffnet – eben aus ökonomischen Überlegungen. Da sie zuletzt aber zusehends Stimmen verlor, übt sie sich nun in dem, was in Deutschland auch Friedrich Merz versucht: ein Ausweichen nach rechts.
Die neue Regierung aber wird es nicht leicht haben, unter anderem, weil sie aus einer nach rechts gerückten LDP und einer in vielen Punkten noch weiter rechts positionierten IJP besteht. Weil der neuen Koalition eine Mehrheit fehlt, wird sie – wie es schon der abgetretene Shigeru Ishiba über ein Jahr versucht hat – wechselnde Mehrheiten herstellen müssen. Jene Parteien links der Mitte werden dafür kaum zu haben sein. Oppositionsführer Yoshihiko Noda von der liberalen Verfassungsdemokratischen Partei (CDPJ) hat bis zur Abstimmung am Dienstag versucht, eine Mehrheit für Takaichi zu verhindern. Hinzu kommt: LDP und IJP sind sich zwar bei Fragen wie Aufrüstung, Gesellschaftspolitik und einer generell wieder strengeren Migrationspolitik weitgehend einig. Aber auf anderer Ebene könnte es schwierig werden.
Regierungschefin wird ihr Programm kaum umsetzen können
Den zuletzt gestiegenen Lebenshaltungskosten will Sanae Takaichi insbesondere durch höhere Staatsausgaben entgegenwirken, ähnlich wie einst ihr Mentor und nunmaliger Amtsvorgänger Shinzo Abe, der Japan von 2012 bis 2020 regierte. Die IJP aber steht für einen fiskalisch konservativeren Kurs und wird der LDP hierfür anderswo Kompromisse abverlangen. Wie lange das funktioniert, ist ungewiss.
Viele Beobachterinnen in Tokio gehen schon davon aus, dass Sanae Takaichi wenig von dem, was sie eigentlich will, wird durchbringen können. Selbst bei ihrer Haltung zu Japans Kriegsvergangenheit wird sie vorsichtig sein müssen. Den Yasukuni-Schrein in Tokio, der Japans Kriegsgefallene und damit auch einige Kriegsverbrecher ehrt, hat sie in früheren Jahren wiederholt besucht. Es im Amt wieder zu machen, würde die Beziehungen zu China und Südkorea deutlich verschlechtern. Aber hält sie von Besuchen am Yasukuni-Schrein Abstand, enttäuscht sie Unterstützer aus ihrem nationalistischen Lager. Unzufriedenheit wird Takaichi kaum vermeiden können.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.