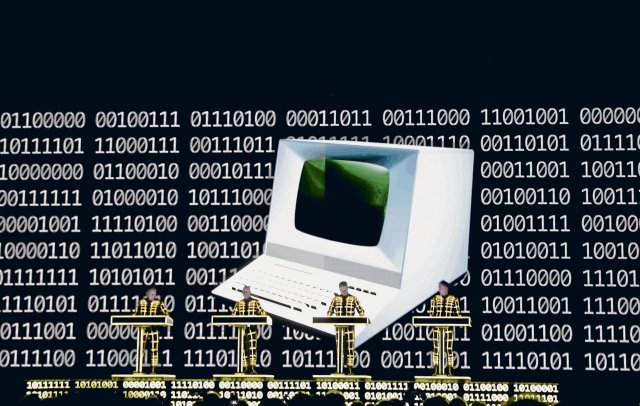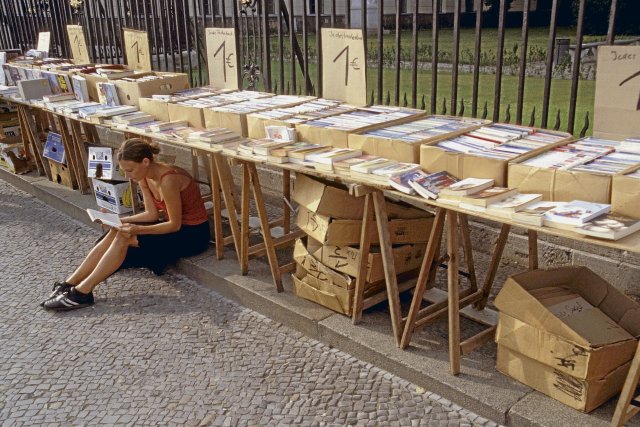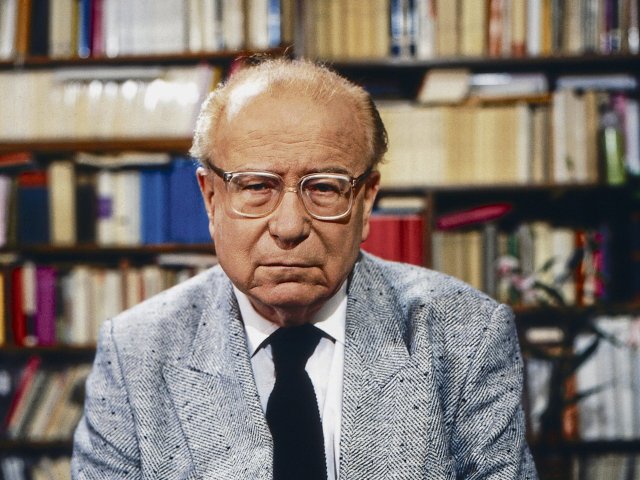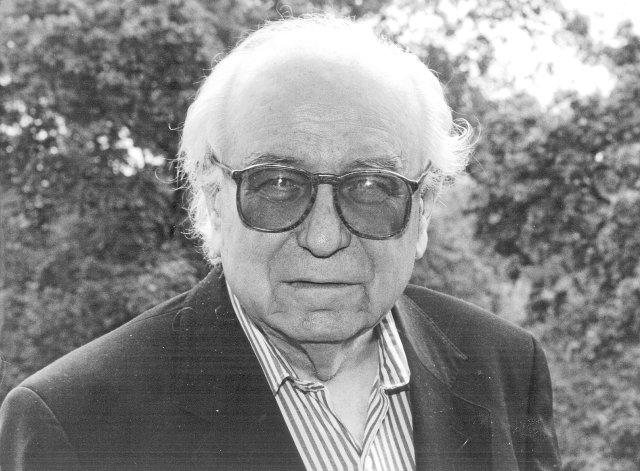- Kultur
- Deutsches Theater Berlin
Der Welt zum Trotz
Am Deutschen Theater Berlin verknüpft Ildikó Gáspár Kleists »Die Marquise von O....« mit der Geschichte von Gisèle Pelicot

Sizilien, 1965. Die 17-jährige Franca Viola wird von ihrem ehemaligen Verlobten am Zweiten Weihnachtsfeiertag entführt, über Tage gefangen gehalten und mehrfach vergewaltigt. Durch diesen Missbrauch entehrt, wollte ihr Peiniger sie heiraten, ihr Ansehen wiederherstellen und so einer Strafe entgehen. Viola widersetzte sich dem öffentlichen Erwartungsdruck und der Täter musste in Haft.
Budapest, 2013. Die zweifache Mutter Erika Renner wird von einem Ex-Partner in ihrer Wohnung zunächst sediert, dann verätzt er ihr Geschlecht mit einem Laugengranulat. Die Vorstellung, dass dieser Folter eine Vergewaltigung vorangegangen ist, liegt nahe, ist aber nicht beweisbar. Es folgt eine zähe juristische Auseinandersetzung, die das Opfer dieser Untat weiter demütigt.
Avignon, 2024. Es kommt zum Strafprozess gegen Dominique Pelicot und 50 weitere Männer. Pelicot hatte über Jahre seine Frau betäubt und vergewaltigt sowie von zahlreichen anderen Männern vergewaltigen lassen. Das Opfer, Gisèle Pelicot, verzichtete darauf, über den Fall anonym verhandeln zu lassen. Sie machte die Gewalt und die Täter dahinter öffentlich.
Die Schicksale von Franca Viola und Erika Renner sind in Deutschland heutzutage kaum bekannt. Nur die schwer begreifbare Tat, deren Opfer Gisèle Pelicot wurde, hat eine anhaltende Debatte ausgelöst. Im Entsetzen über solche Untaten scheinen sich viele einig – obwohl die Rechtsprechnung bis vor wenigen Jahren etwas anderes suggeriert hat. Aber viele Fragen, die das Stichwort »Rape Culture« berühren, bleiben unbeantwortet.
Franca Viola, Erika Renner, Gisèle Pelicot, sie alle begegnen uns in »Die Marquise von O. und – « der ungarischen Regisseurin Ildikó Gáspár, die mit dieser Arbeit am Deutschen Theater Berlin debütiert hat. Heinrich von Kleists Novelle »Die Marquise von O....«, die die Grundlage für diesen Theaterabend bildet, ist vielleicht die berühmteste Schilderung einer Vergewaltigung, die die deutsche Literaturgeschichte kennt.
Die titelgebende Marquise, eine junge Witwe, befindet sich – sie weiß nicht, wie – in anderen Umständen. Sie weiß sich nicht anders zu helfen, als eine Zeitungsanzeige zu schalten, in der sie den Vater inständig bittet, sich bei ihr zu melden und durch Heirat die Familienehre wiederherzustellen. Zuvor war die Marquise in die Hände russischer Soldaten gelangt, von denen sie erst durch einen unbekannten Offizier »befreit« wurde. Wochen später sprach dieser Offizier bei ihr vor und wollte sie zur Frau nehmen.
Nach dem Antrag bemerkte die Marquise ihre Schwangerschaft und wurde von ihrer Familie zunächst verstoßen. Der Offizier aber ließ sich – »Der Welt zum Trotz«, wie er betonte – von seinen Absichten nicht abbringen. Erst als er sich auf die geschaltete Annonce hin meldete, werden die tieferen Gründe seines Handelns klar: Der Offizier ist der Vater des ungeborenen Kindes; die geplante Hochzeit dient einer Art »Wiedergutmachung«.
Stück für Stück, das ist die literarische Strategie hinter dieser Erzählung, wird dem Leser offenbart, was sich zugetragen hat. Kleist lässt die Beschreibung der Vergewaltigung aus und versteckt den Missbrauch hinter einem Gedankenstrich. Daher rührt der etwas umständliche Titel von Gáspárs Inszenierung. In der gut 200 Jahre währenden Rezeptionsgeschichte der Novelle wurde das Verbrechen oftmals verkitscht, verharmlost, romantisiert. Die Dramaturgin Jasmin Maghames unternimmt in ihrem Beitrag einen etwas irritierenden Versuch zur Ehrenrettung Kleists und sieht die Schuld vor allem bei seinen fehlgeleiteten Interpreten.
Es dürfte klar sein, dass man heutzutage Kleists Stoff weder als Liebesgeschichte lesen noch ihn dergestalt auf eine Bühne bringen kann. Die Gewalttat und die verqueren gesellschaftlichen Konventionen, die das Opfer, nicht den Täter, als ehrlos erscheinen lassen, können nicht einfach ausgeblendet werden. Ein Versöhnungsschluss mitsamt Heirat ist an Zynismus kaum zu übertreffen.
Ildikó Gáspár lässt die Spieler an die Rampe treten, ein bisschen Begleitmusik auf Keyboard und E-Gitarre, und »Die Marquise von O....« nacherzählen. Ins Spiel gerät hier niemand. In Kleists Text hat sie die Geschichten von Franca, Renner und Pelicot montiert. Patriarchale Gewalt wird uns in ihrer Kontinuität präsentiert. Notwendig ist es sicher, über überkommene Vorstellungen von Ehre zu reden, über männliche Gewalt und die Entlastung von Tätern. Aber die Regie schafft es nicht, die Novelle szenisch aufzubereiten. Die realen Geschehnisse wiederum vermögen, auf der Bühne wiedergegeben, Entsetzen auszulösen. Inszenatorisch bleibt auch hier vieles auf der Strecke. Die Schrecken der Gewalt werden referiert, um mit dem Holzhammer Aktualität zu demonstrieren.
Der kollektive Konsum von gewaltpornografischem Theater wird als gemeinschaftsstiftende Maßnahme zelebriert, in deren Folge das Publikum sich betroffen zeigen darf. Nur eine Analyse der Verhältnisse, die den Schrecken hervorbringt, bleibt den Zuschauerinnen und Zuschauern verwehrt.
Nächste Vorstellungen: 2., 8. und 25. November
www.deutschestheater.de
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.