- Wirtschaft und Umwelt
- COP 30
Klimagipfel am Hochrisikobereich
Globale Emissionsminderung drängt – doch die Verschmutzer haben eigene Pläne

Die USA entsenden keine hochrangigen Vertreter zur COP 30.» Diese Äußerung eines Sprechers des Weißen Hauses kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém hat bei vielen NGO-Vertretern für Erleichterung gesorgt. Washington ist unter Donald Trump aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, darf bei diesem Gipfel aber noch mitmischen. Kaum auszumalen, was eine starke Delegation Washingtons, gespickt mit rechten Klimawandelleugnern und fossilen Lobbyisten, bei den zweiwöchigen Verhandlungen anzurichten vermöge.
Der Vorgang zeigt aber auch, wie gering die Erwartungen an die COP 30 sind. Diese steht unter keinem guten Stern angesichts geopolitischer Spannungen, der Tendenz zu bilateralen Handelsdeals und zunehmenden rechten Gegenwinds gegen jegliche Klimapolitik. Zehn Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens sind Fortschritte schwieriger denn je. Dabei werden sie immer dringender: «Die tropischen Korallenriffe haben wir vermutlich bereits verloren», sagt der Meteorologe Frank Böttcher, Veranstalter des Extrem-Wetter-Kongresses. «Spätestens ab 1,5 Grad Erwärmung betreten wir auch bei weiteren Kippelementen den Hochrisikobereich.»
Die Klimadiplomatie setzt indes auf business as usual, wie aus der Agenda für Belém hervorgeht. Es steht eine Entscheidung zur Ausweitung der Anpassungsfinanzierung an. Weiter beraten wird über die bei COP 29 in Baku vertagte Frage, wie die jährlich 1,3 Billionen US-Dollar an notwendigen Klimafinanzierungen für arme Länder mobilisiert werden können. Ob die große Lücke bei den nationalen Klimaplänen (NDCs), die für das Pariser 1,5-Grad-Ziel bei Weitem nicht ausreichen, Thema wird, ist unklar. Gastgeber Brasilien möchte heikle Punkte aus dem geplanten «Mantelbeschluss» heraushalten und den Waldschutz stärken, um die Konferenz als Erfolg verbuchen zu können.
Damit wollen sich nicht alle Delegationen zufriedengeben. Druck macht die High Ambition Coalition – eine von den Marshall-Inseln gegründete Gruppe von Staaten, die sich am 1,5-Grad-Ziel und an Solidarität mit vulnerablen Ländern orientieren. Kurz vor dem Start in Belém hat sie eine verbindliche Vereinbarung über die rasche Schließung der Emissionslücke bei den NDCs und Schritte zur Reform der internationalen Finanzarchitektur gefordert. Die Erklärung wurde von 22 Staaten, vor allem aus Europa, Lateinamerika und von kleinen Inselstaaten, unterzeichnet. Letztere sind in ihrer Existenz bedroht, brauchen dringend echte Fortschritte in Klimaschutz- und Finanzfragen.
Die Klimadiplomatie setzt indes auf business as usual.
Die wird es aber nur geben, wenn die großen Verschmutzer China, USA und EU ebenfalls auf «High Ambition» setzen und an einem Strang ziehen. Das Paris-Abkommen kam erst zustande, als die Präsidenten in Washington und Peking ein überraschendes Klimabündnis schlossen. Davon ist nichts mehr übrig: In Trumps zweiter Amtszeit wurde der strategische Klimadialog der beiden Weltmächte auf Eis gelegt.
Und so werden die großen Drei bei den Verhandlungen in Belém nur eigene Zwecke verfolgen. China ringt als Sprecher der großen Schwellenländer um mehr Einfluss auf internationaler Bühne. «Wichtige geopolitische Veränderungen prägen das globale Klimaschutzhandeln», erläutert die NGO Germanwatch. Gleichzeitig wollen Peking & Co. bisher keine echten Finanzierungsverpflichtungen für arme Länder abgeben, ohne die das Billionenziel aber unerreichbar bleiben wird. Dass sich in Belém daran etwas ändert, ist unwahrscheinlich.
Ähnlich vage handelt China beim Klimaschutz. Zwar hat Präsident Xi Jinping bei der UN-Generalversammlung erstmals eine absolute Emissionssenkung um sieben bis zehn Prozent bis 2035 versprochen. Dies ist aber nicht mehr als eine Good-Will-Bekundung, denn als nationale Verpflichtung im Rahmen des Paris-Abkommens hat Peking dies bisher nicht an die UN gemeldet. Außerdem rechnet Martin Kaiser von Greenpeace vor, dass für den 1,5-Grad-Pfad mindestens 30 Prozent nötig wären.
Das spiegelt sich auch im Energiesektor wider. China hat zwar in den vergangenen Jahren wie kein zweites Land die Wind- und Solarenergie ausgebaut, deren Leistung sich gegenüber 2020 versechsfacht hat. Zudem schreitet die Elektrifizierung des Verkehrs voran. In diesem Jahr wurden über 7,5 Millionen Batteriefahrzeuge verkauft, mehr als im Rest der Welt zusammen. In beiden Bereichen geht es indes um kommerzielle Exportinteressen. China will Weltspitze bei Green Tech werden, was auch im Fünfjahresplan 2026 bis 2030 deutlich wird.
Gleichzeitig baut die Volksrepublik den besonders klimaschädlichen Kohlesektor weiter massiv aus: von neuen Minen über Infrastruktur für den Transport bis hin zu Kraftwerken. Laut der «Global Coal Exit List» der NGO Urgewald wurden im vergangenen Jahr zwei Drittel aller weltweiten Finanzierungen neuer Kohleprojekte von chinesischen Banken getätigt, und auch andere Länder erweitern ihre Förderung aufgrund der großen Nachfrage aus China. Zudem verweist Urgewald auf den Ausbau des Kohlechemie-Sektors, wo fast die Hälfte der neuen Projekte weltweit auf die Volksrepublik entfällt. «Hierbei werden deutlich mehr Treibhausgase freigesetzt als bei der Verbrennung von Kohle in einem Kraftwerk», erklärt Geschäftsführerin Heffa Schücking.
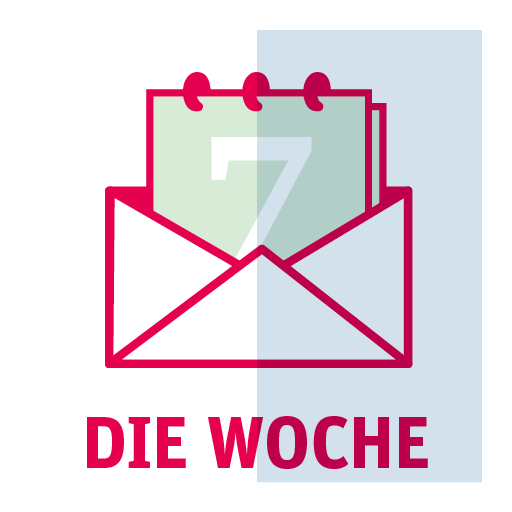
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Daher überrascht es nicht, dass mittlerweile etwa ein Drittel der globalen CO2-Jahresemissionen auf China entfällt. Pro Kopf liegt der Ausstoß etwa auf dem Niveau Deutschlands – wobei die westlichen Industriestaaten historisch einen weit größeren Anteil am Treibhaus Erde haben, woraus sich eine höhere Minderungsverantwortung ableitet.
Davon will die Regierung in den USA gar nichts wissen. Das Land ist mit 13 Prozent die Nummer zwei bei den globalen Emissionen, und das mit höherem Pro-Kopf-Ausstoß als China. Auch hier gibt es eine Dichotomie im Energiebereich: Trump hat die Parole «Drill, baby, drill» ausgegeben und setzt auf neue Öl- und Gasprojekte. Man lockert zudem Klimaschutzregeln, etwa die Einstufung von CO2 als gesundheitsgefährdend. Auf der anderen Seite sprechen wirtschaftliche Interessen für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. In den Bundesstaaten Iowa, South Dakota, Kansas und Oklahoma werden bereits mehr als 40 Prozent des Stroms aus Windkraft gewonnen, und das konservative Texas hat kürzlich Kalifornien als Solarspitzenreiter überholt. Zudem wurden regionale Emissionshandelssysteme mit CO2-Preisen implementiert.
Die Hoffnung mancher NGOs, dass nach dem Ausstieg der USA ein Bündnis EU-China die Klimadiplomatie vorantreibt, hat sich nicht erfüllt. Gegenseitiges Misstrauen und wirtschaftliche Interessen stehen dem im Wege. So hat Brüssel Strafzölle für chinesische Importe von E-Autos verhängt und denkt auch bei Solarzellen darüber nach. Gleichzeitig geht die EU – mit sechs Prozent Anteil viertgrößter Emittent – auch nicht als Vorreiter nach Belém. Die UN-Fristen für neue Klimapläne ließ man verstreichen; die Umweltminister einigten sich erst jetzt auf eine maue Vorgabe für 2035 mit Schlupflöchern. Martin Kaiser geht noch einen Schritt weiter und meint, die Zieldebatten seien derzeit ohnehin sinnlos, da die Umsetzung aller EU-Klimaschutzmaßnahmen vom Emissionshandel bis zum Verbrenner-Aus auf Druck von Industrie und der politischen Rechten infrage gestellt wird.
Das trifft auch die Klimafinanzierung: So hatte Deutschland als einer der wichtigsten Geldgeber erstmals im vergangenen Jahr seine Zusage von sechs Milliarden Euro für den globalen Süden erfüllt. Schon kommen Kürzungen zugunsten des Militärs: In diesem Jahr sei nur noch mit 4,5 bis 5,3 Milliarden und 2026 mit 4,4 bis 5,0 Milliarden Euro zu rechnen, rechnet Jan Kowalzig von Oxfam vor.
Trotz solcher Vorzeichen setzt COP-30-Gastgeber Brasilien auf die Botschaft des «mutirao» – doch die «gemeinsame Anstrengung» muss wohl von anderen kommen als den großen Verschmutzern. Immerhin scheint es nicht das große Bündnis der Blockierer mit den USA an der Spitze zu geben. Donald Trump wird in Belém dennoch vor Ort sein, und zwar gleich 6000-fach. Die Street-Art-Künstler Jens und Lasse Galschiøt wollen die Delegierten mit Miniaturskulpturen des US-Präsidenten konfrontieren. Samt der Botschaft: «King of Injustice».
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






