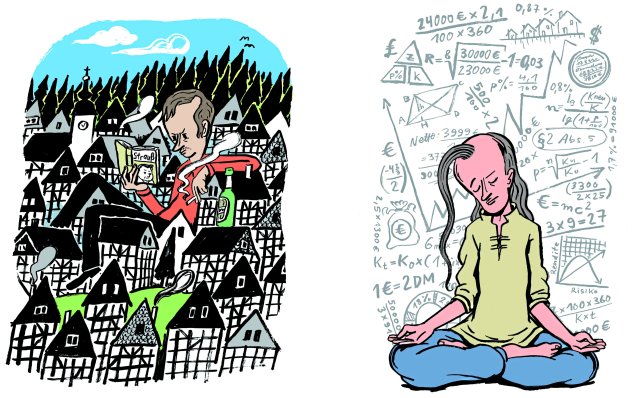- Kultur
- Estland
Filmfest Cottbus: Sehnsucht nach Vergangenheit
Beim 35. Filmfestival Cottbus lag der Fokus auf Estland

Mit rund 140 Filmen aus rund 30 Produktionsländern lud das 35. Filmfestival Cottbus sechs Tage dazu ein, den osteuropäischen Film zu entdecken. Dieses Jahr startete eine dreijährige Reihe mit dem Schwerpunkt auf das an Russland angrenzende Baltikum: Estland, Lettland und Litauen.
Den Anfang machte das 1,37 Millionen Einwohner zählende Estland. Das postsowjetische Land gehört zu den am dünnsten besiedelten Staaten der Europäischen Union, im Schnitt wohnen circa 30 Einwohner auf einem Quadratkilometer. Fast ein Drittel lebt in der Hauptstadt Tallinn. Seit 1997 findet hier jährlich im November eines der 15 wichtigsten und einflussreichsten Festivals der Welt statt, das Black Nights Film Festival.
In Tallinn feierte auch Estlands diesjähriger Oscar-Beitrag Premiere: In Meel Paliales Low-Budget-Tragikomödie »Rolling Papers« trifft ein unglücklicher Verkäufer (Mihkel Kuusk) in Tallinn auf einen Hedonisten und Träumer. Der Film ist nur an Wochenenden entstanden, weil Paliale mit einem jungen Team von Studenten arbeitete.
Koproduktionen werden mit finanziellen Anreizen nach Estland geholt, um der Produktionslandschaft auf die Sprünge zu helfen.
Bei einer Diskussionsveranstaltung trafen sich »Rolling Papers«-Schauspieler Kuusk, Schauspielerin Maarja Johanna Mägi (»Aurora«), Regisseurin Helen Takinn (»Life and Love«), Drehbuchschreiber Sven-Sander Paas (»Baa-Baa!«, »Breadsong«), um über den Status quo des estnischen Films zu sprechen. Moderiert wurde die Runde von dem estnischen Filmkritiker Andrei Liimets.
Mihkel Kuusk berichtet von den entspannten Dreharbeiten bei »Rolling Papers« – ohne große Requisite, Spezialeffekte oder Ähnliches. »Wir wollten einfach nur Menschen vor die Kamera bringen.« Das Projekt sei ganz ohne Geld- und Zeitdruck entstanden, der Schnitt schon während der Dreharbeiten passiert. Das Team konnte so immer einschätzen, welche Szenen sie noch mal drehen werden. Die Art des Geschichtenerzählens ändere sich durch den geringen Budgetrahmen, so Helen Takinn. Das mache Filmteams erfinderisch.
Die estnische Geschichte der Filmproduktion ist relativ jung. Bis 1991 war sie in Moskau zentralisiert. Estnischsprachige Filme waren möglich, allerdings war das eigene nationale Narrativ eingeschränkt. Mit dem Zerfall der Sowjetunion erlangte Estland Unabhängigkeit, aber Kinoketten, Verleihstrukturen und das gesamte Funding-System verschwanden. Das Land baute sich nach und nach als Filmproduktionsland auf.
Durch die Gründung des Estnischen Filminstituts (EFI) wurden wieder Projektförderungen möglich. In den letzten Jahren lag die durchschnittliche Fördersumme für einen estnischen Spielfilm bei circa 300 000 bis 500 000 Euro. Der Fokus bei der EFI-Förderung liegt auf künstlerisch anspruchsvollen Projekten, wodurch Genre-Produktionen oder nicht so erfahrene Filmemacher schlechtere Chancen haben. Auch wer zu kommerziell produzieren möchte, hat keine Förderchance.
Schauspielerin Maarja Mägi schätzt, dass rund die Hälfte der Produktionen heutzutage in Lettland gefilmt wird. Das sei nicht nur billiger, ergänzt Helen Takinn, obendrein gebe es Steuervergünstigungen. Einen Teil müsse man dann, um eine estnische Produktionsförderung zu bekommen, auch im Heimatland (Estland) drehen. Koproduktionen werden mit finanziellen Anreizen nach Estland geholt, um der Produktionslandschaft auf die Sprünge zu helfen. Das wohl prominenteste Beispiel ist Christopher Nolans »Tenet«, bei dem die Opern- sowie einige Straßenszenen in Tallinn gedreht wurden. Die Produktionsfirma erhielt ein Cashback von 1,36 Millionen Euro, was bei einer Rückerstattung von 30 Prozent auf ein Produktionsvolumen von 4,65 Millionen Euro aus estnischen Fördertöpfen schließen lässt.
Internationale Koproduktionen und Service-Produktionen (zum Beispiel »Tenet«) bringen Know-how, moderne Ausrüstung und spezialisierte Jobs nach Estland. Doch sie erschweren die Terminplanung für estnische Filme, da sie die besten Crews und Ressourcen binden. Oft sind estnische Produktionen nur Junior-Partner, sodass keine echten »estnischen Geschichten« erzählt werden.
In der Close-up-Reihe wurde auch über die Schwierigkeiten von Schauspielenden in Estland diskutiert. Schauspielerin Maarja Johanna Mägi, Mitglied der diesjährigen Wettbewerbsjury, war in der Schwerpunktreihe durch »Aurora« mit einem Film vertreten.
Auf der diesjährigen Berlinale stellte sie sich damit als EFP-Shooting-Star (European Film Promotion) dem internationalen Publikum vor, hat seitdem zum ersten Mal einen Agenten für internationale Produktionen. Für Mägi ist dies ein sehr wichtiger Schritt, um nicht von Estlands doch recht kleinem Filmmarkt abhängig zu sein. Außerdem arbeitet sie nicht nur für Film-, sondern auch für Theaterproduktionen. Mihkel Kuusk ist auch als Musiker tätig.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Moderator Andrei Liimets merkt an, dass die meisten estnischen Produktionen in die Vergangenheit, nicht aber in die Gegenwart blicken. Regisseurin Helen Takinn sieht auch die Art der Förderung als einen der Gründe, warum historische Stoffe so beliebt sind. Schon vor der Produktion werde berechnet, wer sich den Film ansehen könnte. Historische Stoffe seien sowohl im schulischen Kontext als auch bei älteren Menschen sehr beliebt, wodurch die Zielgruppe größer sei. Nationalstolz spiele auch eine Rolle.
Durch Produktionen wie »Rolling Papers« sehe sie langsam die Kluft zwischen Arthaus- und Publikumskino kleiner werden. Sie freut sich, dass tiefergehende Geschichten mehr Raum bekommen. Auch weil »die künstlerische Qualität langsam in den Filmstil einfließt«. Schon jetzt hat sich für das Filmteam der Mut gelohnt.
Das Filmfestival in Cottbus ist gerade vorbei, doch vom 28. bis 30. November präsentiert das Sputnik-Kino am Südstern in Berlin die 9. Estnischen Filmtage. Dort werden neben den auch in Cottbus gezeigten Spielfilmen »Aurora«, »Rolling Papers« und Andres Puustusmaas’ Spionagethriller »One-Dimensional Man« weitere Spiel- und Kurzfilme laufen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.