- Politik
- EU-Kommission
Weiteres Heimlichzentrum in Brüssel
Kommission plant eigene Aufklärungszelle der EU – bisher wurde nur die militärische Sparte aufgewertet

Um die europäische Geheimdiensttätigkeit zu stärken, prüft die EU-Kommission den Aufbau eines neuen Lagezentrums. Es soll laut der »Financial Times« in ihrem Generalsekretariat in Brüssel angesiedelt werden und Beamt*innen von Diensten der EU-Staaten beschäftigen. Hintergrund sei die veränderte geopolitische Lage durch Russlands Invasion der Ukraine und Warnungen von US-Präsident Donald Trump, die amerikanische Unterstützung für Geheimdienste in Europa zu reduzieren. Auch der Wegfall von Informationen der mächtigen britischen Inlands- und Auslandsdienste dürfte nach dem Brexit für Defizite gesorgt haben.
Eine mit den Plänen vertraute Person sagte der »Financial Times«: »Die Nachrichtendienste der EU-Mitgliedstaaten wissen viel. Die Kommission weiß viel. Wir brauchen einen besseren Weg, um all das zusammenzufügen.« Eine Kommissionssprecherin bestätigte die Pläne gegenüber der Zeitung. Ein Zeitplan sei dafür aber noch nicht festgelegt. Allerdings wurden die Überlegungen den 27 EU-Mitgliedern auch noch nicht offiziell mitgeteilt.
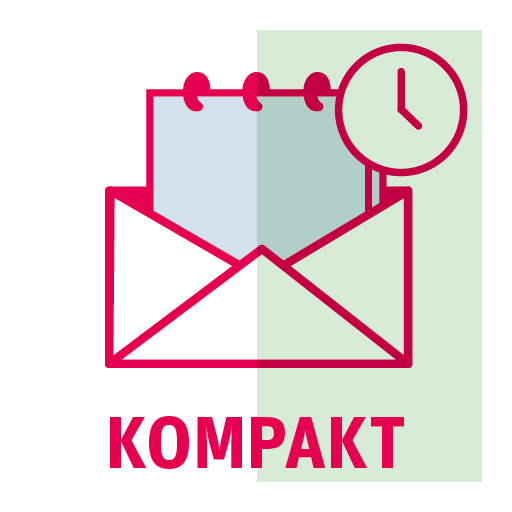
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Gemäß den Verträgen haben die EU-Staaten der Kommission keine Kompetenz übertragen für die Koordination oder gar Einrichtung von Geheimdiensten. Stets wird deshalb in Brüssel die Trennung zwischen »strafverfolgungsrelevanten« und »nachrichtendienstlichen« Tätigkeiten betont. Trotzdem verfügt die EU bereits über zwei derartige Zellen – mit stark beschränkten Möglichkeiten.
Das zivile IntCen (Intelligence Analysis Centre) ist dem Europäischen Auswärtigen Dienst unter der Außenbeauftragten Kaja Kallas angeschlossen und wertet Berichte und Dokumente aus, die Mitgliedstaaten anliefern. Die Bundesregierung ist dort mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst vertreten. Das IntCen kooperiert auch mit der EU-Polizeiagentur Europol – soweit bekannt allerdings nur im strategischen Bereich zur Erstellung von Bedrohungsanalysen. Mit dem EUMS INT Direktorat existiert eine ähnliche Struktur beim EU-Militärstab, die ebenfalls Informationen aus den Mitgliedstaaten sowie EU-Einsatzgebieten verarbeitet. Beide Zentren bilden zusammen die Single Intelligence Analysis Capacity (SIAC) und gelten als Hauptabnehmer von Aufklärungsdaten des EU-Satellitenzentrums. Ihre Berichte werden auch an deutsche Ministerien, Geheimdienste und die Bundeswehr verteilt.
Die EU hat keine Kompetenz zur Koordination von Geheimdiensten.
-
Auch die neue Geheimdienstzelle bei der EU-Kommission soll keine Kompetenzen haben, Überwachungen anzuordnen oder Agenten zu führen. Der Vorstoß zur Schaffung einer zusätzlichen Geheimdiensteinheit in der Kommission stößt trotzdem auf Widerstand hochrangiger Beamt*innen im Diplomatischen Dienst der EU. Sie befürchten eine Doppelung der Aufgaben mit dem IntCen und sehen die Zukunft der Einrichtung bedroht, so die »Financial Times«. Demnach soll die Neugründung aber auch auf Bedenken hinsichtlich des IntCen gründen, das besonders bei der Reaktion auf Russlands »hybriden Krieg« als wenig effektiv angesehen wird.
Vorschläge für einen eigenen EU-Geheimdienst sind nicht neu. Bereits in seiner »Europa-Rede« hatte etwa der damalige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, am 13. September 2017 vorgeschlagen, eine »Europäische Aufklärungseinheit« einzurichten. In ihrer ersten Amtszeit warb dann von der Leyen 2022 in ihrer Rede zur »Lage der Union« dafür, im Rahmen neuer Leitlinien der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik das EUMS INT und das IntCen zu einem zivil-militärischen »Zentrum für Situationsbewusstsein« zu fusionieren.
Durchgesetzt hat sich bislang allerdings nur die Stärkung der militärischen Sparte. Ein im Oktober 2024 vom EU-Militärstab gebilligtes Dokument sieht eine umfassende Umstrukturierung des EUMS INT vor. Demnach sollen fünf neue Positionen für abgeordnete nationale Expert*innen geschaffen werden, darunter ein Abteilungsleiter für »hybride Bedrohungen«, Analyst*innen für Marine, Luftwaffe und Weltraum sowie für Informationsmanagement und Geodaten. Einer der Schwerpunkte ist auch die Bedrohung der wirtschaftlichen Sicherheit.
Der Informationsaustausch zwischen ihren nationalen Geheimdiensten ist grundsätzlich ein heikles Thema für EU-Mitglieder. Große Staaten wie Frankreich mit umfangreichen Spionagekapazitäten sind laut der »Financial Times« zurückhaltend, sensible Informationen mit Partnern zu teilen – eine Ausnahme bildet der Fall um den Kryptomessenger Encrochat, den mutmaßlich der französische Militärgeheimdienst gehackt und die Daten der Polizei und Justiz in zahlreichen EU-Staaten zur Verfügung gestellt hat.
Für Komplikationen sorgt außerdem die zunehmende pro-russische Rhetorik vieler Parteien innerhalb der EU und insbesondere Ungarn, wo die Fidesz die Regierung stellt. Auch aus diesem Grund dürften sich die EU-Hauptstädte gegen Bestrebungen wehren, neue Geheimdienstbefugnisse für Brüssel zu schaffen – deren Erkenntnisse dann auch Ungarn zur Verfügung stünden.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






