- Berlin
- Luftverkehr
Ultrafeinstaub landet in den Lungenbläschen
Grundschulkinder im Umfeld des Flughafens BER für wegweisende Studie zu gesundheitlichen Risiken untersucht

Wie ungesund der Feinstaub ist, den Kraftfahrzeuge verursachen, ist der Wissenschaft bekannt. Noch ungenügend erforscht sind die gesundheitlichen Risiken durch ultrafeine Partikel, die in einer Zone von zehn Kilometern rund um Flughäfen in höherer Konzentration als üblich auftreten. »Wir betreten Neuland«, sagt Josef Cyrys vom Münchner Helmholtz-Zentrum. »Wir sind am Anfang der Auswertung, aber am Ende der Datenerhebung.«
Am Mittwochabend stellt Cyrys gemeinsam mit Miriam Wiese-Posselt von der Berliner Universitätsklinik Charité erste, noch bescheidene Zwischenergebnisse einer Langzeituntersuchung vor. Vor ihnen sitzen im Dialogforum am Bahnhof Schönefeld Kommunalpolitiker aus dem Umland des Hauptstadtflughafens BER.
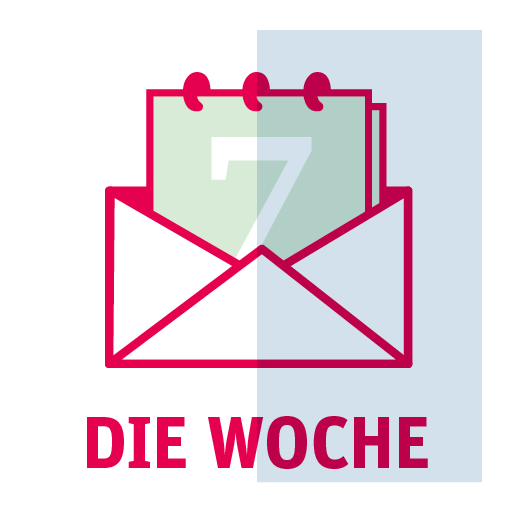
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im Februar 2020 begannen Messungen an 16 ausgewählten Grundschulen in Berlin und Brandenburg. Zehn dieser Schulen befinden sich in der Nähe des in Schönefeld gelegenen Airports BER – konkret beispielsweise westlich in Blankenfelde-Mahlow und östlich in Eichwalde und Schulzendorf. Daneben widmen sich die Wissenschaftler auch drei Schulen in der Nähe des alten Flughafens Berlin-Tegel. Sie können, weil sie noch rechtzeitig mit Messungen und mit medizinischen Untersuchungen der Schulkinder begonnen haben, die Situation vor und nach der Schließung der Aiports in Tegel betrachten, ebenso die Lage vor und nach Eröffnung des neuen Großflughafens BER Ende Oktober 2020. Vergleichen können sie ihre Daten außerdem mit Ergebnissen von drei Schulen in der Berliner Innenstadt. Diese liegen weit weg von beiden Flughäfen und wurden genau deshalb zu Vergleichszwecken ausgewählt.
Über die Jahre ist bis jetzt immer mal wieder eine erhöhte Konzentration von Ultrafeinstaub nachgewiesen worden. Aber wenn die Messgeräte mehr Feinstaub registrierten, dann in durchaus erheblichem Maße – zwischen 8000 und 12 000 Partikel in einem Kubikzentimeter Luft. Es handelt sich um extrem kleine Partikel mit einer Größe von lediglich 10 bis 20 Nanometern. Diese wandern eingeatmet in die Lungenbläschen und verteilen sich über das Blut bis ins Gehirn, wo sie ähnlich wie das Coronavirus das Geschmacksempfinden abschalten könnten. Das Essen schmeckt dann vorübergehend fade.
Durch die Partikel ausgelöste chronische Entzündungen könnten ganz verschiedene gesundheitliche Folgen nach sich ziehen: Bluthochdruck bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall, und bei Asthma-Patienten könnten die Atembeschwerden noch zunehmen. Das Risiko, an Parkinson oder Alzheimer zu erkranken, dürfte steigen. Schlussendlich wird ein Zusammenhang mit Diabetes und Fettleibigkeit vermutet und auch eine höhere Gefahr von Frühgeburten und untergewichtigen Säuglingen.
Dass die Partikel vom Flughafen herrühren und die beschriebene Wirkung haben, ist allerdings schwer nachzuweisen. Dies abzuklären, dazu dient die Studie. Finanziert wurde sie unter anderem von der Schutzgemeinschaft der Umlandgemeinden des BER.
1000 Jungen und Mädchen, die die einbezogenen 16 Grundschulen besuchten, sind von Krankenhaushygienikerin Wiese-Posselt und ihren Kollegen medizinisch untersucht worden; 693 Kinder gleich dreimal, andere nur ein- oder zweimal. Insgesamt 2732 Untersuchungen hat es gegeben. In Fragebögen wurde erfasst, ob die Schüler an einer Autobahn wohnen oder die Eltern rauchen. Es wurde ihr Blutdruck gemessen und in einem Lungenfunktionstest überprüft, wie gut die Kinder stoßweise ausatmen können. Wie lange sich die Mädchen und Jungen konzentrieren können, das testeten die Wissenschaftler ebenfalls.
Nachdem die Phase der Datenerhebung abgeschlossen ist, beginnt die Auswertung so richtig erst jetzt. Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist eingebunden. Viel kann Wiese-Posselt zu den ersten Zwischenergebnissen noch nicht sagen, immerhin so viel, dass die Fähigkeit der Kinder zum stoßweisen Ausatmen an Tagen mit erhöhter Konzentration von Ultrafeinstaub nicht signifikant beeinträchtigt war. Die Experten vermuteten aber ohnehin schon vorher, dass sich Einflüsse erst in der jetzt anschließenden Langzeituntersuchung zeigen würden. Wer den verschiedenen Sorten von Ultrafeinstaub nicht über Jahre ausgesetzt ist, dem macht dieser offenbar nichts aus.
Wenn ein Gesundheitsrisiko nachgewiesen ist, was dann? Vielleicht Luftfilter in die Klassenräume stellen? Dass wirklich eine hochreine Luft wie in einem Operationssaal gewünscht ist, vermag sich Wiese-Posselt nicht vorzustellen. Die entsprechenden Anlagen wären auch teuer und kompliziert zu warten. Im Bettenhochhaus der Charité belegen sie eine ganze Etage. Aber Bäume und andere Gewächse schlucken Staub. Es wäre sinnvoll, die Schulhöfe zu bepflanzen.
Da schießt sich der Kreis an diesem Abend. Denn unmittelbar vor den beiden Medizinern hat Grit Diesing von der Berliner Regenwasseragentur den Kommunalpolitikern Projekte vorgestellt, Niederschlagswasser versickern und verdunsten zu lassen oder für die Bewässerung des Stadtgrüns zu verwenden, statt es in die Kanalisation einzuleiten. Beispielhaft nannte Diesing dabei auch die Umgestaltung des vorher auf 4000 Quadratmetern versiegelten Schulhofs einer Waldorfschule in Prenzlauer Berg. Der Hof wurde bis auf 700 Quadratmeter entsiegelt und begrünt.
Das stößt bei dem Klimabündnis auf Interesse, dass die Städte und Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, Wildau, Schulzendorf, Königs Wusterhausen, Schönefeld und Blankenfelde-Mahlow im März 2023 mit dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gebildet haben.
»Klimaanpassung ist keine abstrakte Zukunftsfrage«, findet der Dialogforums-Vorsitzende und Ex-Landtagsabgeordnete Helmut Barthel (SPD). »Jeder kann etwas dazu beitragen, und leere Kassen sind keine Ausrede!« Zusammen 414 000 Einwohner leben in der Region, die wegen dieser dichten Besiedlung eigentlich der denkbar schlechteste Standort für den neuen Hauptstadtflughafen war.
»Wir sind am Anfang der Auswertung, aber am Ende der Datenerhebung.«
Josef Cyrys Helmholtz-Zentrum
»Wir planen, planen, planen und kommen nicht zum Tun«, bedauert Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD). Das Netzwerk sei dazu gedacht, mehr Tempo aufzunehmen.
Doch bisher hat das Netzwerk auch nur erste Ideen gesammelt, die noch nicht einmal vorausgewählt sind. Bis dann etwa ein Radweg gebaut wird, könnte es wieder lange dauern.
Es wäre naheliegend, mögliche Schäden für Gesundheit und Klima zu reduzieren, indem weniger geflogen wird. Das Gegenteil ist der Fall. Als der BER während der Corona-Pandemie eröffnet wurde, herrschte Flaute im Luftverkehr. Nur 4612 Starts und Landungen hat es im Dezember 2020 gegeben. Jetzt waren es im Oktober 2025 schon stolze 18 554 – und am 17. Oktober wurde zu Beginn der Herbstferien ein neuer Redord erzielt, als an einem einzigen Tag 102 059 Passagiere abgefertigt wurden.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






