- Wirtschaft und Umwelt
- Transformationskonflikte
Industrie auf dem Scheideweg
Wer gewinnt? Transformation zwischen Rechtsruck und Arbeitskampf

»Wenn ich über die feministische Energiewende spreche, denken viele, ich rede über Probleme von Frauen und über böse Männer. Das ist natürlich auch wichtig, aber mir geht es um etwas anderes«. Cara New Daggett von der Polytechnischen Universität Virginia erntet zu Beginn ihres Vortrags auf dem Herbstforum der Hans Böckler Stiftung gleich ein paar Lacher.
Zwei Tage lang geht es hier um Transformationskonflikte. Das sind Herausforderungen, die für Gesellschaft und Arbeitswelt während des sozial-ökologischen Wandels entstehen. Ein rege debattiertes Beispiel in Deutschland ist die Automobilbranche, wo Ängste vor Arbeitsplatzverlusten Fragen der Umstellung auf grüne Energien gegenüberstehen. Die Debatten auf dem Herbstforum drehen sich um Rechtsruck, soziale Absicherung, Gewerkschaftsarbeit und die Aushandlung zwischen Ökologie und Wirtschaft.
Daggett erzählt von den Appalachen in den USA. Dort wendet die Kohleindustrie eine besonders kostengünstige Methode des Tagebergbaus an: Sie sprengt ganze Gipfel in die Luft. Häufig, wie Daggett anhand von Karten veranschaulicht, in unmittelbarer Nähe von Schulen. Auf Fotos kann man sehen, wie schwarze Staubwolken über den Bildungseinrichtungen wabern. Durch die Methode sanken die Jobs in der Region in der Kohleindustrie. Das und die Umweltverschmutzung entfachten breite Gewerkschaftsproteste und – häufig weiblich angeleitete – Klimaproteste.
Die Freunde der Kohle setzten in ihrer Kampagne auf traditionelle Geschlechterrollen und hypermaskuline Bilder wie Autorennen oder Jagdmotive. Das Feindbild: Umweltaktivist*innen und Feminist*innen.
2002 reagierte die Kohleindustrie mit der Kampagne »Friends of coal« (deutsch: Freunde der Kohle). Nostalgische Bilder sollten Menschen wieder mit Kohle aussöhnen. Die Freunde der Kohle setzten in ihrer Kampagne auf traditionelle Geschlechterrollen und hypermaskuline Bilder wie Autorennen oder Jagdmotive. Das Feindbild: Umweltaktivist*innen und Feminist*innen.
2015, als Donald Trump auf seiner ersten Wahlkampftour in den Apalachen ankam, war Hypermaskulinität bereits eng mit der Kohleindustrie verknüpft. Daggett will aufzeigen, wie die geschlechterspezifische Arbeitsteilung dazu dient, Kapitalismus und die Klimakrise aufrecht zu erhalten. Sie nennt das Phänomen »Petromasculinity«, also »Petromaskulinität«.
»In Deutschland scheint es einen besonders fruchtbaren Nährboden für antidemokratische Kräfte zu geben.«
Andreas Hövermann WSI
Wie sich autoritäre Strömungen die Sorgen und Ängste von Arbeiter*innen in der ökologischen Wende zu eigen machen, zeigt sich auch in Deutschland. Namentlich profitiert dort die AfD, wie Andreas Hövermann vom Wirtschafs- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Böckler-Stiftung feststellt. Transformationsängste sind demnach ein Faktor für das Erstarken der vielmals als rechtsextrem definierten Partei. »In Deutschland scheint es einen besonders fruchtbaren Nährboden für antidemokratische Kräfte zu geben«, warnt er.
Im Hintergrund dieser Entwicklung stehen Machtkämpfe. Wie eine Studie des Fachmagazins »Nature« vergangenes Jahr aufzeigte, muss die Weltwirtschaft aufgrund des Klimawandels bis 2050 bereits mit einem Einkommensverlust von 19 Prozent rechnen. Auch aufgrund der sinkenden Arbeitsproduktivität, weil beispielsweise auf Baustellen bereits hitze- oder kältebedingt Arbeitsstunden wegfallen. Der Schweizer Baumeisterverband forderte in Reaktion darauf eine Erhöhung der Höchstarbeitszeit auf 58 Stunden. Auch die aktuelle Politdebatte dreht sich stark um die Verlängerung der Lebensarbeitszeiten im Rentenalter und den Ausbau der Wochenarbeitsstunden.
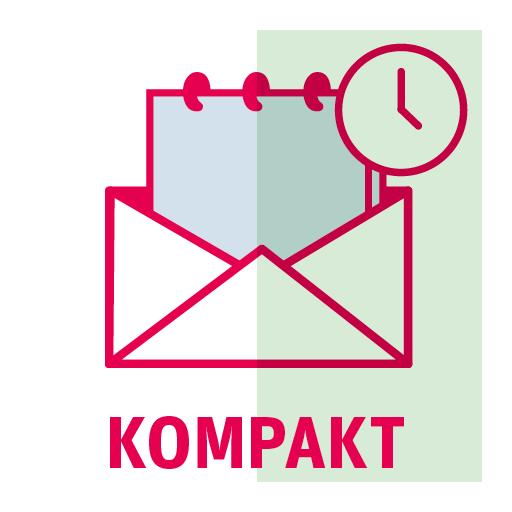
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Eine Maßnahme, die zur ökologischen Umverteilung beitragen könnte und die auf der Konferenz immer wieder Erwähnung findet, ist jedoch das Gegenteil: Arbeitszeitverkürzung. Simon Schaupp vom Institut für Sozialforschung Frankfurt zufolge gibt es einen branchenunabhängigen Faktor, der etwa 80 Prozent aller Arbeiter*innen eine, und das sei ihre Erschöpfungserfahrung. Praktischerweise führt weniger Arbeit auch zu weniger Produktion und damit Umweltverschmutzung. Überlange Arbeitszeiten seien im Übrigen auch »der Kern patriarchaler Arbeitsteilung« und demnach eine Möglichkeit zum Schulterschluss. Lange Arbeitszeiten haben unter anderem zum Ergebnis, dass anderweitige Aufgaben an Frauen ausgelagert werden.
Allerdings, ganz so einfach ist die Sache nicht, wie Schaupp einräumen muss. So habe sich beispielsweise in der Schweiz gezeigt, dass gerade Migrant*innen, die besonders von schlechten Arbeitsverhältnissen betroffen waren, wenig Interesse an Arbeitszeitverkürzungen hatten. Sie waren darauf angewiesen, innerhalb kürzester Zeit möglichst viel zu arbeiten und zu verdienen.
Daggett und ihre Arbeit sind inzwischen, ebenso wie die Klimabewegung in den Appalachen, Angriffen der US-amerikanischen Rechten ausgesetzt. Das habe ihr gezeigt, dass ihre Arbeit vielleicht wichtiger sei, als sie ursprünglich gedacht habe, schließt sie. »Wenn rechte Strömungen hinter dir her sind, ist das ein Zeichen dafür weiterzumachen«.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






