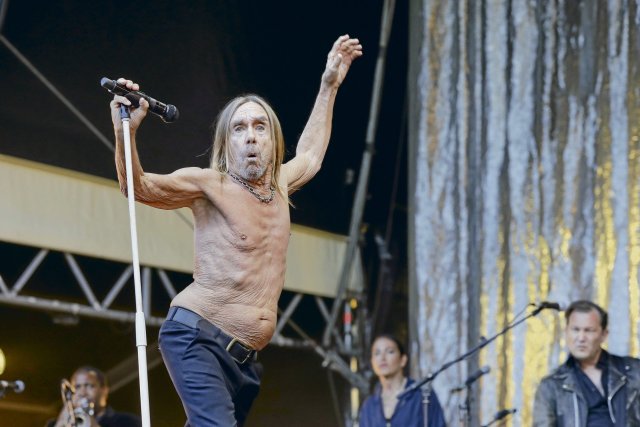Papas nativas – das wahre Gold der Anden
Die Vereinten Nationen haben 2008 zum Internationalen Jahr der Kartoffel gekürt. In Peru wurde das mit Freude zur Kenntnis genommen, denn aus den Anden stammt die Urkartoffel
»T'ikapapa« steht auf den transparenten Plastikbeuteln, die längliche, gelbe und lilafarbene Knollen enthalten. »Papa nativa«, zu deutsch so viel wie Landsorte, steht daneben. Der Verkaufsständer im Supermercado Wong enthält nicht mehr allzu viele der begehrten Säcke. »Papas nativas, die in einer Höhe über 3500 Meter in den Anden wachsen, sind begehrt«, erklärt Miguel Lau. Er ist bei der größten Supermarktkette Perus für den Einkauf zuständig und kann kaum genug der farben- und formenfrohen Kartoffeln nach Lima schaffen. Papas nativas sind begehrt in Peru, denn die Landsorten sind aufgrund ihres höheren Vi-tamin- und Mineralstoffgehalts gesünder als die industriell in tieferen Lagen produzierten Sorten. Und sie schmecken besser. Das behaupten nicht nur die Chefköche zahlreicher feiner Restaurants wie des »Huaca Pucllana« in Lima, sondern eben auch normalverbrauchende Peruaner, die die heimische Kartoffelvielfalt mehr und mehr zu schätzen lernen.
Für Kleinbauern wie Justino Haman, der in einer Höhe von 4000 Meter über dem Meeresspiegel Kartoffeln anbaut, ist das eine gute Nachricht. »Viele der alten Sorten, die sehr gut an die Bedingungen dieser Höhe angepasst sind, konnten wir früher kaum verkaufen. Heute bekommen wir anständige Preise dafür«, sagt der kleingewachsene Bauer aus der Gemeinde Chahuaytire.
Chahuaytire gehört gemeinsam mit fünf weiteren Gemeinden zu einem einzigartigen Projekt – dem Kartoffelpark von Pisac, nahe der alten Inkametropole Cuzco im Andenhochland gelegen. Dort sollen bis 2020 alle der mindestens 3000 Sorten von Papas nativas angebaut werden. Eine lebende Samenbank wollen die Bauern anpflanzen und damit verhindern, dass die heimische Kartoffelvielfalt verloren geht. »Die Vielfalt haben wir zu schätzen gelernt«, erklärt Justino Haman, »denn früher haben wir auch die industriellen Sorten angebaut. Viele von uns waren aber nicht mehr in der Lage, Pflanzenschutzmittel und Dünger zu bezahlen, damit die Kartoffelsorten auch ordentlich trugen.« Schnee von gestern, denn heute werden im Kartoffelpark nur noch traditionelle Sorten angebaut. »Die sind widerstandsfähiger und schmackhafter«, sagt Milton Gamarra, einer der Kartoffeltechniker, der hilft, berät und auch darüber wacht, dass die vereinbarten Regeln im 12 000 Hektar großen Park eingehalten werden. »Zwei Kartoffeltechniker gibt es in jeder Gemeinde, und die sind für die Aussaat, die Pflege und die Registrierung der Sorten im Kartoffelpark verantwortlich«, erklärt Milton Gamarra.
Der schlaksige Agrartechniker koordiniert die Arbeit der Techniker. Die treffen sich regelmäßig im Zentrum des Kartoffelparks, einem hellen, im Stil der Inkas gebauten Steinhaus, das im unteren Bereich des Parks angesiedelt ist. Dort steht auch der Computer – das Hirn des Kartoffelparks. Alle wesentlichen Informationen über die Kartoffelpflanzen, die bisher im Park angebaut werden, sind hier gespeichert. »Zu jeder Pflanze wird derzeit eine Legende angelegt, für die wir Techniker die Informationen zusammentragen«, erläutert Orestes Castañeda. Der in einen der traditionellen Ponchos gehüllte Agrartechniker zeigt auf die Spalten auf dem Bildschirm. Eigenschaften der Sorte, ihr Geschmack, die kulturelle Bedeutung und eine etwaige medizinische Wirkung sind dort aufgelistet.
Viele der Informationen über die rund 1200 Knollensorten, die bisher in den Datenbanken gespeichert sind, stammen aus den Gemeinden. »Die Alten geben weiter, was sie über die Pflanzen im Park wissen. Sie freuen sich, dass ihr Wissen gefragt ist, und so lernen wir Jüngeren viel Neues über die Pflanzen, aber auch über unsere eigene Identität«, sagt Castañeda. »Letztlich versuchen wir das traditionelle Wissen der Gemeinschaft zu erhalten«, fasst Milton Gamarra zusammen. Für Gamarra und die Bauern des Kartoffelparks ist die vielfältige Knolle mehr als ein Nahrungsmittel, sie ist ein Stück eigene Geschichte.
Das wissen auch die Wissenschaftler vom Internationalen Kartoffelinstitut (CIP) in Lima, und sie wissen es auch zu schätzen. »Wir arbeiten mit einer ganzen Reihe von Gemeinden zusammen, unterstützen sie bei der Auswahl ihres Saatguts, beraten bei der Schädlingsbekämpfung und versuchen auch alte Sorte, die aus den Anbauregionen verschwunden sind, wieder heimisch zu machen«, erklärt William Roca. Er hat die Kooperation mit dem Kartoffelpark besiegelt und in den letzten Jahren mehrere Hundert Kartoffelpflanzen aus Lima in die Dörfer des Kartoffelparks bringen lassen, wie es ein gemeinsamer Vertrag vorsieht. Auch bei der Lagerung und beim Vertrieb der Papas nativas haben die Techniker des in Lima ansässigen Instituts geholfen. In endlosen Kühlräumen lagern dort in Gläsern mehr als 4000 Kartoffel- und 1200 Süßkartoffelsorten. Ein genetischer Schatz, der nahezu alle Erbinformationen enthält – von den ersten Wildkartoffeln, die vor über 8000 Jahren in den Anden entdeckt und dann kultiviert wurden, bis zur beliebten deutschen Speisekartoffel Linda, die in diesem Jahr vom Markt genommen werden soll.
Rund dreitausend dieser Sorten stammen aus dem andinen Hochland. In Dörfern und Gemeinden wie Quello Quello oder Cuyo Grande weiß man oftmals mehr über ihre Eigenschaften und Wirkungen als im CIP. So gibt es Kartoffelsorten, die nur zu Hochzeiten gegessen werden. Andere – vor allem buntfleischige Kartoffeln – werden hingegen den Schwachen und Kranken vorbehalten. Heute weiß man weshalb: »Die Kartoffeln wirken antioxidativ und verhindern Zellschädigungen, was man sich in der Krebstherapie zunutze machen will«, erklärt Alejandro Argumedo, Direktor der Organisation Andes, die die Bauern des Kartoffelparks seit 1998 berät. »Von diesem traditionellen Wissen können wir nur lernen«, betont William Roca. Bis Mitte letzten Jahres hat er die Abteilung Artenvielfalt des CIP geleitet und auch Gemeinden in anderen Anbauregionen Saatgut zur Verfügung gestellt. »Das wirkt manchmal Wunder, denn gesunde Kartoffelpflanzen bringen bis zu 70 Prozent höhere Erträge«, weiß sein Nachfolger am CIP, David Tay.
Die enge Kooperation zwischen Institut und Gemeinden will auch er fortsetzen, denn »schließlich ist unser eigentlicher Auftrag die Armutsbekämpfung. Und die Armut kann man am besten durch höhere Erträge und Nahrungssicherung reduzieren«, argumentiert lachend der kahlköpfige Experte, der aus Borneo stammt und sich mit Spanisch noch schwer tut. Dazu wird am CIP nicht nur neues Saatgut entwickelt, sondern auch nach neuen Verkaufsperspektiven für die alten Sorten Ausschau gehalten.
Ausgesprochen erfolgreich, denn die Idee, die Papas nativas in Kooperation mit der Supermarktkette Wong zu vertreiben, entstand im Team des CIP-Experten André Devaux. Erst vor wenigen Monaten wurde T'ikapapa, zu deutsch Blume der Kartoffel, als innovatives Projekt ausgezeichnet. Doch das Team von André Devaux hat noch weitere Asse im Ärmel, um den Kartoffelbauern zu neuen Perspektiven aus ihren alten Sorten zu verhelfen. So werden am Flughafen von Lima bunte Kartoffelchips zu kaufen sein, und den Rohstoff, eben die orangefarbenen, blauen und violetten Kartoffeln, deren Fleisch oft noch Muster aufweist, liefern die Papas nativas. »Jalca Chips« oder »Inca’s Gold« heißen die bekannten Marken.
»Derzeit gibt es ein internationales Unternehmen, dass die bunten Chips herstellen will«, berichtet Veronica Valcarcel, die im CIP-Team von André Devaux für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das Team arbeitet in unterschiedlichste Richtungen: Bücher über die nahrhaften Superknollen sind genauso erschienen wie erste Kochbücher in Kooperation mit bekannten Restaurants, aber auch ein neues Kartoffelpüree haben sie auf den Markt gebracht. Knallgelb leuchtet das »Puré Andino« auf dem Teller und schmeckt deutlich aromatischer als die bekannte Konkurrenz. Hergestellt wird das Püree aus der goldgelben Tumbay-Kartoffel, die – wie sollte es anders sein – natürlich auch zu den Papas nativas zählt. Erste Importanfragen gibt es aus Japan, die Produktion in der Fabrik in Cajamarca, im Norden Perus, wurde bereits erweitert.
Für Bauern wie Justino Haman sind das gute Nachrichten, denn so steigt die Nachfrage nach seiner Ernte und womöglich auch der Erlös für die Superknollen aus den Anden. Ob die auch den Weg nach Deutschland finden werden, steht allerdings vorerst zu bezweifeln. Zu klein sind die Ernten, als dass sich der Export lohnen würde. Aber auch das kann sich ändern – mit Hilfe des CIP.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.