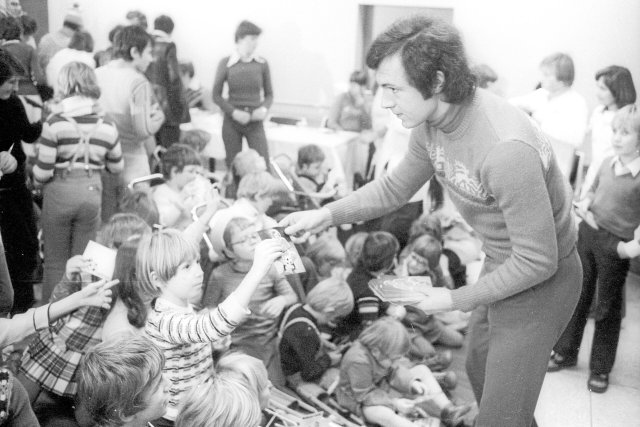Gegen die allgemeine Stimme
Heute wird der Essayist und Verleger Gerhard Wolf 80 Jahre alt
Hölderlin, lesen wir, hat plötzlich »sehr an Glauben und Mut gewonnen« – nämlich durch das, was Hegel da verfasste: »Eine Sehnsucht nach einem reinern, freiern Zustand hat alle Gemüter bewegt und mit der Wirklichkeit entzweit.« So steht es im biografischen Essay, in der poetischen Chronik, in dem großen Text »Der arme Hölderlin«, den Gerhard Wolf 1968/69 geschrieben hatte, der in der DDR aber erst drei Jahre später erscheinen durfte. Ein Denken, das sich mit der Realität überwirft? Eine Bestandsaufnahme. Der Traum von Freiheit? Ein frecher Traum. Mit dem Erzählen über Hölderlin verfocht der Autor die hartnäckige Hoffnung, dass Öffentlichkeit eine Gewähr für das Beste, das Bestzudenkende sei, ein Konzept, das auf die Aufklärung zurückgeht und in Immanuel Kant einen Vorvater hatte: »Publicitas« sei »das Prinzip, das dafür sorgt, dass Politik und Moral zu einer Stimme kommen«. Das war der aufreibende Konfliktstoff damals, im Staat der großen utopischen Worte, der ein unaufhaltsam ermüdender Kleinstaat blieb. Und auf der Strecke blieb, indem er sich selbst zur Strecke brachte.
»Nachtzeit des Geistes« heißt es im »Armen Hölderlin« – das war wieder so eine Metapher: für die parteiverordnete Verweigerung jenes lichten Überschusses der freien Gedanken, ohne den keine Gesellschaft lebendig bleiben kann; das Dunkel aber auch als Schutz- und Impulsraum für das Aufglimmen nicht bezähmbarer Fantasien vom ganz anderen, helleren Leben; nachts beginnen die Augen zu leuchten. Christa und Gerhard Wolf gehörten zu den Erstunterzeichnern des Protestes gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann, jener wohl entscheidenden Charakterprobe für DDR-Intellektuelle und -Künstler. Gerhard Wolf wurde aus der Partei geworfen (zur sozialistischen Idee kam er über Anna Seghers und Andersen-Nexö, »nie übers Marxistische«); beide aber sind in dem Land geblieben, dem es zwar nicht an der Idee mangelte, dem aber stärker und stärker die Ideen gegen alle Mängel ausgingen und somit: die Menschen. Die DDR hat wohl mehr Exilanten im eigenen Land produziert, als das sichtbare tägliche Leben in diesem System erkennen ließ. Gemeinsam mit seiner Frau stand Gerhard Wolf für eine ehrvolle, schmerzbewusste, aber nicht unglückliche Existenz in der Zerreißprobe – zwischen Loyalität und Abkehr, Bejahung und Kritik, Zorn und Nachsicht, Angriff und Verteidigung, Ernüchterung und Melancholie, Vorschlag und Rückzug.
Christa Wolf wurde wie keine andere schriftstellerische Stimme im knirschenden Staat zur Instanz einer unbestechlich ehrlichen und zugleich selbsthelferisch wirkenden literarischen Seelsorge. Genau dieser Umstand war es wohl, der sie ausharren ließ – die Mission dieser Autorin hatte etwas vom Ethos, das manchen Arzt in der DDR hielt, weil man seine Patienten nicht verlässt. Seine Leser verließ man ebenso wenig, wenn man s o l c h e Bücher schrieb wie Christa Wolf. Vielleicht führt von hier aus der logische Weg hin zu jenem Aufruf »Für unser Land«, mit ungelenkem Pathos hinausgeflammt, als das Land im Winter 1989/90 bereits verloren war, und viele wunderten sich damals, wieso die kluge Frau Wolf da noch mittat. Weil es bei ihr zum Hass nie reichte, weil die Not beherrschbar war, reichte es nun auch nicht für die wegwerfende Freude. Und noch einmal, ein letztes besiegelndes Mal rauschten jene Seelen in die Enttäuschung, die es im Herbst 1989 so ernst gemeint hatten mit Erneuerung, mit der Chance also, Gemüter und die Wirklichkeit endlich unterm Signum eines wirklichen Sozialismus zu vereinen. Und am Ende, also jetzt, steht das Bild einer beharrlich schweigenden großen Erzählerin, die sich konsequent herausgenommen hat aus den öffentlichen Erregungen und tiefe Zweifel hegt am Sinn öffentlicher Befunde. Alles weise Schweigen ist immer auch ein traurig stimmendes Schweigen, aber was weiß einer, der draußen raunt ...
War das eben ein zu langzeiliger Aufenthalt bei Christa Wolf, wo doch Gerhard Wolf Geburtstag hat? Wer aber ist ohne den anderen zu erklären, wenn zwei ein Leben teilen, einander stützen und in »unüberwindlicher Nähe« (Botho Strauß) einen gegenseitig sich belebenden Eigensinn behaupten wie behüten. Schön, wenn es so ist, und nie kam der Verdacht auf, er sei »nur« der Mann seiner Frau. Das ist die »konventionelle Reporterfrage«, über die er immer schon lachen konnte. Vergleiche hat er mit Grazie ausgehalten, vor allem diesen: Er besitzt seit jeher im Gegensatz zu Christa Wolf wohl einen eher gemäßigten Ehrgeiz – man sieht ja Menschen am Gesicht an, ob sie sich mehr vornehmen, als der Seele gut tut, und Gerhard Wolf hat ein gütiges, entspanntes Gesicht. In ihrem Buch »Ein Tag im Leben« schreibt Sie über Ihn, er sei ein »Meider«, wo sie selber auf Menschen zuginge. »Ihm gehe es mehr darum, sagt er, seine Sachen zu machen. Dass dabei keine Weltliteratur herauskomme, wisse er, wo entstünde heute überhaupt Weltliteratur, und wer entscheide darüber. Aber deshalb sei doch alles andere nicht unsinnig.«
»Nicht unsinnig.« Dieser Untertreibung, selbst wenn auch sie eine Kunst ist, sei hier Einhalt geboten. Wolf hat neben seiner Herausgeberschaft (»Märkischer Dichtergarten«) betörende Bücher geschrieben, poetisch, verdichtet, in meisterlichem Rhythmus: etwa das über Johannes Bobrowski (»Beschreibung eines Zimmers«). Soeben erschien als wunderschönes Insel Taschenbuch noch einmal das 1985 bei Aufbau erstveröffentlichte Sammelwerk »Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht – Projektionsraum Romantik«, Texte von Christa und Gerhard Wolf, ja, man darf sagen, einer berührender als der andere; Kleist und die Günderrode, die Arnims und Heine, »Der arme Hölderlin« – Essay und Erzählung in faszinierender Paarung, und dies Ungebundene, wie Gerhard Wolf schreibt, ist als kräftige Fantasie »beharrlich aufzurufen – gegen Bindungen, in welcher Form und Maske von Correctness sie uns fesseln möchten, ›wie und worüber die allgemeine Stimme heute mit uns spricht‹«.
Vor genau fünf Jahren saß Wolf bei Günter Gaus im Fernsehstudio; der Sohn eines Buchhalters und einer Schneiderin, 1938 in Bad Frankenhausen geboren, gab im RBB Auskunft »Zur Person«. Ein Mann ganz ohne jenen sattsam bekannten, durchwachsenen Ton, der sich so unangenehm auskennt in den Wahrheiten und im Grunde nur eine einzige Wahrheit kennt. Gerhard Wolf war bei Gaus ganz und lächelnd mit dem Geständnis beschäftigt, nur immer sich selber meinen zu können, wenn er über Erfahrungen mit der Welt rede. Kein Wonnebad im Allgemeinplatz. Kein Sympathie-Haschen bei den Griesgramen vom Dienst. Kein Hauch Ost-Larmoyanz, kein Quäntchen West-Schelte. Der da Antwort gab, offenbarte sich somit als Gegenteil eines ängstlichen Menschen, denn nur der Ängstliche besteht zwangsläufig auf klarem Kurs. Wer aber auf die unverschämte Lust der Welt, sich in allem Gegensätzlichen zu spiegeln, nicht mit Porenverschluss reagiert, der strahlt ein schönes Einverständnis mit den Dingen aus, ein Einverständnis, das nichts mit Ergebenheit zu tun hat, aber viel mit einer Neugier, die skeptisch bleibt, und einer Skepsis, die doch weiter Neugier zeugt. Und was könnte den Doppelblick der Welt besser ausdrücken als der römische Gott Janus – Wolf nannte seinen Verlag für Lyrik und Kunst, 1990 gegründet, »Janus press«, und sein Gott schaut in drei Richtungen, zurück ins Überlieferte, vor ins Moderne und: ins Gesicht des Lesers.
»Die Poesie hat immer Recht« hieß das Buch, das vor zehn Jahren dem Autor, Verleger und Herausgeber Wolf zum 70. Geburtstag gratulierte (den Titel des Buches zitierend, das der Jubilar einst über Louis Fürnberg geschrieben hatte). Schon als Redakteur des Deutschlandsenders der frühen DDR-Jahre war er sich der Poesie sicher. Er stritt für die Verbreitung von Rilke, sein Chefredakteur damals verbot das, freilich nicht ohne darauf zu verweisen, dass er dessen Gedichte zu Hause natürlich ebenfalls lese. Ein noch höherer Funktionär zu Wolf: Diese Doppelgesichtigkeit sei nicht schlimm, der Genosse lese Rilke, um sich weiterzubilden, Wolf aber lese wegen des reinen Genusses.
Dieser Mann kann mit aller Lebensschwere spielen und andere davon überzeugen, dies sei wirklich ein leichtes Spiel. »Haltet zusammen!« rief er einst den jungen Lyrikern Volker Braun, Heinz Czechowski, Karl Mickel, Sarah und Rainer Kirsch zu (mit diesem aufrüttelnden Wort seinen eigenen Hölderlin-Text aufbietend); als Lektor hatte er bereits Gedichte von Peter Huchel, Stephan Hermlin und Erich Arendt zu Büchern werden lassen; und die nächste Generation derer, denen er zu Öffentlichkeit verhalf, hießen Bert Papenfuß, Sascha Anderson, Stefan Döring, Jan Faktor. Eine lange Geschichte der Treue, der Widerstandskraft gegen die Kulturpolitik, gegen Stasi-Schnüffeleien und Verbote, letztlich eine Geschichte der Durchhaltefähigkeit. Die Lebensgeschichte des Gerhard Wolf: alt werden zu dürfen mit dem, was ihn immer beglückte – jungen Menschen förderlich ins Werk zu helfen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.