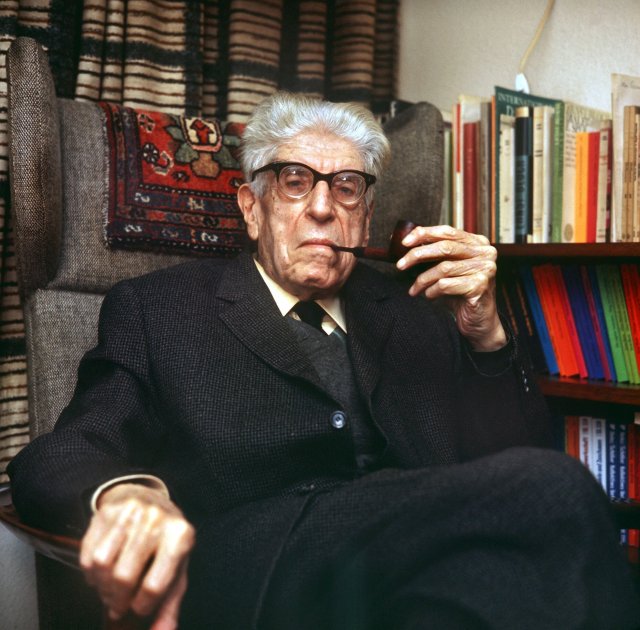Müde Augen
Wettbewerb: »A torinói ló« (The Tourin Horse)
Manchmal weiß man nicht, woher die Müdigkeit kommt. Ob von der Leinwand vorn oder von einem selbst. Bei Béla Tarrs »Das Turiner Pferd« bin ich mir nicht einmal sicher, ob die Müdigkeit nicht ein konstitutioneller Teil dieses hundertzweiundvierzigminütigen Filmkunstwerkes des ungarischen Filmzeitentschleunigers ist. Ein Überdehnungsphänomen.
Dabei ist es noch einer seiner kürzeren Filme. Die erste Hälfte der 90er Jahre verbrachte er mit seinem »Satantango« (nach dem Buch von Lázlo Krasnahorkai, dem Beckett Ungarns), die zweite mit dem Werckmeister-Harmoniack-Epos. Ziemlich tagefüllend beide. Dabei unbedingt sehenswert in ihrer sich selbst zelebrierenden Langsamkeit.
Tarr kann problemlos eine halbe Stunde in der Betrachtung eines gedeckten Tisches verweilen, der bei ihm wie ein Gemälde aussieht, nur unter dem Vorbehalt eines gelegentlichen, aber eher seltenen Ortswechsels einzelner Gegenstände. Bislang jedoch blitzte immer auch jener göttliche Humor dabei auf, zu dem unweigerlich gelangt, wer die Dinge nur lange genug betrachtet.
Doch im »Turiner Pferd« wird er zum Propheten. Was Kunst war, soll Religion werden. Kann das gut gehen?
Tarrs Filme sind wortkarg bis schweigsam, meistens ganz und gar stumm. Wir betrachten Landschaften, wehende Blätter, hören knarrende Türen und herabfallende Regentropfen, aber all das ist nicht zufällig, sondern folgt einer genau geplanten Choreographie. Selten bin ich mir so unsicher wie bei Tarrs Filmen: Ist das nun genial, oder schlicht Wichtigtuerei, Kunst oder Kunstgewerbe, Zeitgewinn oder Zeitverschwendung?
Aber eben die Zeitbegriffe vor dem Horizont des Todes umzudefinieren, ist Tarrs Absicht. Seine Filme sind mythische Netze, in denen sich ab und zu ein Wort oder eine Geste verangen, alles immer sehr klein im Verhältnis zu Ewigkeit. In seinem letzten – großartigen – Film »Man from London« ging es um ein Schiff im Hafen. Da stiegen immer – höchst artifiziell, also so, wie das im wirklichen Leben nie geschieht – Menschen über eine Gangway an Bord oder kamen wieder herunter. Diese Auf- und Absteigenden waren das Metronom des Films, gaben ihm den Takt vor.
Schließlich hat sich mir die Urszene der Schiffsbesteigung aus »Man from London« so tief ins Bildgedächtnis eingegraben, dass ich nun erst wirklich weiß, wie das ist, wenn man von Wasser zu Land wechselt: Es ist wie die Evolution selbst, nur eben viel ausdrucksvoller.
Mitunter ist Béla Tarr zweifellos genial. Ob es auch dieses »Turiner Pferd« ist, weiß ich nicht. Entweder war ich zu müde beim Zuschauen – oder er beim Drehen. Tarr ist natürlich auch das falsche Programm in einer mitternächtlichen Spätvorstellung, wenn man bereits seit morgens früh um neun im Kino sitzt. Und Tarr denkt nicht daran, es einem irgendwie leichter zu machen.
Diese Bilderfolgen wollen schwer und niemals leicht sein. Man kann seine Filme, die auf solche Dinge wie Handlung gern verzichten, einzig nur würdigen, wenn man mit voller Konzentration, gepaart mit meditativer Lust, die Dinge des Lebens in Zeitlupe betrachtet.
Wie dem filmischen Halbschlaf entkommen und einfach ohne schlechtes Gewissen die Augen schließen dürfen? Es gibt Kritiker, die kommen ins Theater (im Kino sieht man es nicht so deutlich) und schlafen, kaum dass sie sitzen. Um dann am nächsten Morgen frisch ausgeruht einen Verriss zu schreiben. Ich erkläre, nicht zu diesen Kollegen zu gehören. Aber die Müdigkeit ist eine wahrhaft verflixte Sache. Zumal die eines ganzen Zeitalters, die Nietzsche im Blick hatte.
Die Natur im »Turiner Pferd« ist auf schweigsame Art gefährlich. Am gefährlichsten ist der Stumpfsinn, der aus ereignislosen Tagen kommt. Das ist vielleicht die gültigste Interpretation der ewigen Wiederkehr des Gleichen bei Nietzsche. Und doch, die in die Natur eingewanderte Melancholie lässt mich hier ziemlich kalt, wirkt mitunter sogar wie Kolportage.
Die Nietzsche-Szene ist nur ein von Tarr eingesprochener Prolog zu dieser von ihm umgekehrt erzählten Schöpfungsgeschichte. Sechs Tage lang schwindet für Vater, Tochter und Pferd das Licht auf ihrem einsamen Hof in der Puszta, am siebenten wird es ganz dunkel: Schwarzblende zum Weltuntergang. Warum also nun Nietzsche?
1889 fiel der Philosoph in Turin einem auf der Straße von seinem Kutscher misshandelten Pferd weinend um den Hals. Auftakt eines Zusammenbruchs, Absturz in ein graues Jahrzehnt geistiger Dämmerung bis zu seinem Tod. Das Dementi auch seines lebenslangen Versuchs, hart gegenüber sich selbst und seinem kranken Körper zu werden, das christliche Mitleid aus der Welt zu verbannen. Aber das ist hier nur eine Metapher: Das Turiner Pferdeschicksal, Nietzsches Philosophenschicksal – es wiederholt sich jeden Tag überall auf der Welt.
Das Leben von Vater Ohlsdorfer (János Derzsi) und seiner Tochter (Erika Bök) wiederholt sich an sechs Tagen ritualhaft. Er erhebt sich aus seinem Bett, sie kleidet ihn an, man kocht eine Kartoffel, die sie mit den Händen essen – er grob zugreifend, sie mit einer Fingerbewegung die Kartoffel auseinanderlegend; man spannt dann das Pferd an, das keine Wagen mehr ziehen kann, man schaut aus dem Fenster, man gießt sich einen Schnaps ein, wartet in völliger Leere oder völliger Erfülltheit (wer kann das wissen?). Alles in vorsätzlich quälender, stummer Langsamkeit. Mehr passiert nicht – bis zum Ende, wenn es dann ganz dunkel wird. Immer nur stille Hingabe an das Schicksal, keine Revolte.
Es gibt, Momente, da glaube ich dem Film nicht, es sind verräterische Details. Derzsi mimt (hier ist das schauderhafte Wort einmal am Platz) den schwerfälligen Landmann, doch einige Male, etwa wenn er Sattel und anderes Zubehör eigenhändig verlädt, wirkt er plötzlich in seinen Bewegungen wie ein großstädtischer Schauspieler, der seinen Koffer ins Auto schwingt, um zum nächsten Drehort zu fahren.
Auch Erika Bök als Tochter schaut ständig so schicksalsernst wie auf dem Wochenendworkshop für tragischen Gesichtsausdruck. Man spürt, etwas stimmt nicht mit dieser himmelstief lastenden Atmosphäre, die hier wie zwangsverordnet wirkt. Nein, am Ende bin ich mir sicher, meine Müdigkeit ist nur eine Fortsetzung der Müdigkeit eines Regisseurs, der all das, was er in »Das Turiner Pferd« sagen will, bereits in seinen früheren Filmen gesagt und also längst in bezwingende Bilder gebracht hat. Bloße Wiederholung ist Bloßstellung von Ratlosigkeit – aber auch diese hier ohne innere Notwendigkeit. So wird »Das Turiner Pferd« selbst zum Indiz für die Fatalität der Ewigen Wiederkehr des Gleichen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.