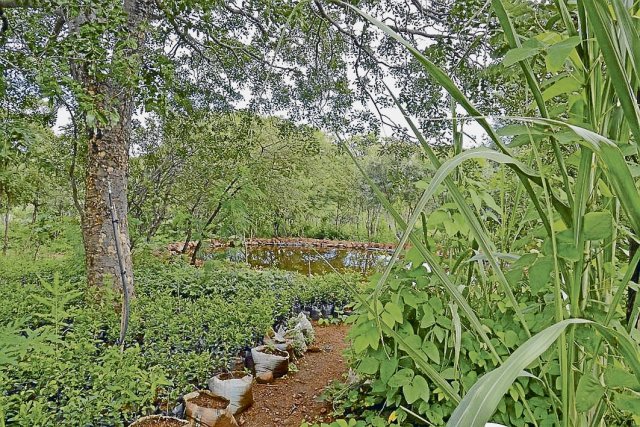Ihren größten Atomwaffentest aller Zeiten unternahmen die USA-Militärs vor 50 Jahren am 1. März 1954 auf dem Bikini-Atoll im Südpazifik.
Mit 15 Megatonnen entwickelte die Wasserstoffbombe die tausendfache Vernichtungskraft der über Hiroshima im Sommer 1945 abgeworfenen Atombombe, die 200000 Menschenleben forderte. Selbst vor Ort anwesende Experten waren von dem gewaltigen Blitz und dem schier endlos wachsenden Atompilz überrascht, denn durch einen Rechenfehler der Atomwissenschaftler im Entwicklungslabor von Los Alamos übertraf die Explosion die erwartete Stärke bei weitem.
Der unvorhergesehen nach Südost drehende Wind trieb die radioaktive Wolke direkt über die benachbarten Marshall-Inseln Rongelap, Rongerik und Utirik und fügte deren Bewohnern schmerzhafte Verbrennungen zu. Auch die 23 ahnungslosen Matrosen, auf dem fast 200 km entfernten japanischen Fischerboot »Fukurya Maru« (Glücksdrachen) wurden von dem atomaren Ascheregen heimgesucht. Während der Funker Kuboyama wenige Monate später starb, siechten die übrigen Besatzungsmitglieder an den Folgen der radioaktiven Verseuchung dahin. »Unser Schicksal droht der ganzen Menschheit. Sagen Sie es denen, die verantwortlich sind - und gebe Gott, dass sie auch hören«, mahnte der Fischer Misaki, eines der verstrahlten Opfer.
Doch die Verantwortlichen hörten nicht. Die USA und Großbritannien unternahmen im Südpazifik und später in der Wüste von Nevada 1146 bzw. 44 Nukleartests. Die UdSSR erprobte auf der Insel Nowaja Semlja und im kasachischen Semipalatinsk 715 Sprengsätze. Nach dem Verlust des kolonialen Testgeländes in der Sahara zündete Frankreich die meisten seiner 215 Atombombenversuche auf den Polynesieninseln Moruroa und Fangataufa. China führte 45 Nukleartests in der Lop Nor Wüste durch. Indien erprobte sechs atomare Sprengsätze in der Thar-Wüste von Rajasthan, und Pakistan unternahm fünf Versuche in den Chagai-Bergen von Belutschistan.
Die Langzeitwirkungen der Nukleartests rufen bis heute massenhaft Leukämie, Schilddrüsen- und andere Krebserkrankungen hervor, sie verursachen genetische Schäden, Erbkrankheiten und Schwächungen der Immunsysteme. Zu den Strahlungsopfern gehören vor allem die Ureinwohner der Testgebiete - die Maori und Malayos in Mikronesien und Polynesien, die Uiguren im chinesischen Sinkianggebiet, die Schoschonen in Nevada, die russischen Siedler auf den Nördlichen Eismeerinseln, die Bauern in den Steppen Kasachstans und schließlich auch die Einwohner im indischen Pokharan und in Chaghi in Pakistan.
Nach Angaben der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) wird jeder jetzt und in den nächsten Zehntausenden von Jahren lebende Mensch von Nukleartests herrührende radioaktive Elemente in sich tragen, die das Krebsrisiko erhöhen. Erst seit dem Jahre 1963 sind oberirdische Kernwaffenversuche ebenso wie Nukleartests im Weltraum und unter Wasser verboten. Mehr als drei weitere Jahrzehnte dauerte es, bis im September 1996 ein umfassender Teststoppvertrag abgeschlossen wurde. 109 Staaten gehören ihm inzwischen an, aber zum Inkrafttreten fehlen noch 12 Länder mit relevanten Nuklearaktivitäten: USA, China, Indien, Pakistan und Nordkorea, Ägypten, Indonesien, Iran, Israel, Kolumbien, Kongo und Vietnam.
Obwohl in Wien seit Jahren eine arbeitsfähige Kontrollorganisation für einen umfassenden Teststopp bereit steht und ein weltweites Überwachungsnetzwerk von insgesamt 321 Beobachtungsposten in 89 Ländern errichtet wird, stehen die Aussichten schlecht. Nach einem zwölfjährigen Moratorium laufen in den Vereinigten Staaten die Vorbereitungen für einen Neustart nuklearer Testexplosionen. Auf 6,4 Milliarden Dollar steigen in diesem Jahr die Ausgaben für das Stockpile Stewardship Program. Offiziell dient es der Sicherheitsüberprüfung des bestehenden Kernwaffenarsenals, wahrscheinlicher ist allerdings, dass Funktionstests neuentwickelter Atomsprengköpfe ermöglicht werden sollen.
Denn für eine neue Kernwaffe »brauchst du wahrscheinlich einen Nukleartest«, räumte der im Pentagon bis vor kurzem für Nuklearfragen zuständige Fred Celec ein. Dementsprechend wird zur Zeit das Versuchsgelände in Nevada für 25 Millionen Dollar modernisiert, und der USA-Kongress verkürzte die Warmlaufphase für die Wiederaufnahme der Kernwaffenversuche von 36 auf 18 Monate. Gleichzeitig schufen die Parlamentarier freie Bahn für die Entwicklung von nuklearen Bunkerbrechern und »Mini-Nukes«.
Wenn die USA die Kernwaffenversuche wieder aufnehmen, werden andere Staaten mit großer Wahrscheinlichkeit folgen. Nicht nur das Schicksal des Teststoppvertrages wäre damit besiegelt, auch der Atomwaffensperrvertrag, regionale Abkommen über kernwaffenfreie Zonen und andere Vereinbarungen auf nuklearem Gebiet gerieten in Lebensgefahr. »Die nukleare Rüstungskontrolle liegt bereits auf der Intensivstation«, warnt Daniel Plesch vom britischen Royal United Services Institute, »die Entwicklung neuer Atomwaffen und erneute Atomtests würden die atomare Abrüstung in die Leichenhalle verlegen.«