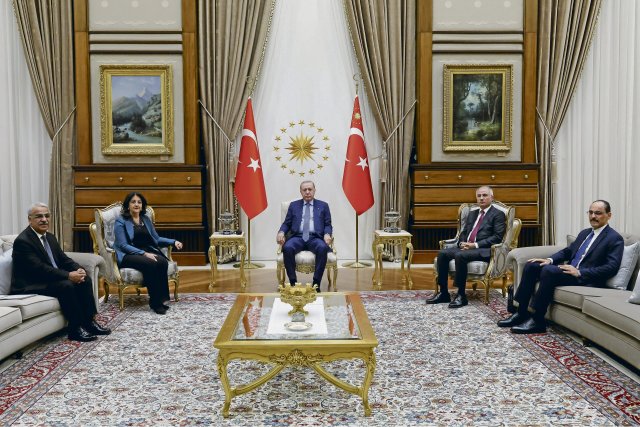- Politik
- Literaturwissenschaftler Hans Kaufmann gestorben
Unorthodoxer Geist und exzellenter Schreiber
Hans Kaufmann, der letzten Sonnabend im 74. Lebensjahr gestorben ist, war eine herausragende Gestalt der DDR-Literaturwissenschaft. Als junger Mann aus Krieg und französischer Gefangenschaft heimgekehrt, wurde er nach seinem Studium zu einem wichtigen Akteur bei der Erneuerung der durch prekäre Traditionen belasteten deutschen Germanistik. Schon seine Dissertation war ein Meilenstein auf diesem Wege, sie galt Heinrich Heines «Deutschland, ein Wintermärchen» (veröffentlicht 1958), war antifaschistisch motiviert und zeigte den Verfasser bereits auf der Höhe seines Vermögens: einer von Marx inspirierten Methodik, tiefreichendem Verständnis des künstlerischen Werks, präziser wissenschaftlicher Analyse und einem Stil fern akademischer Trockenheit und Steife. Der Liebe zu diesem Autor blieb er auch später als Biograph und Herausgeber treu. Hans Kaufmann war fein international renommierter Heine-Forscher.
Sein nächster Schritt galt Brecht, dem er sich auf eine unorthodoxe Weise näherte. Unter dem Titel «Geschichtsdrama und Parabelstück» (1962) zielte er auf gattungstheoretische Verallgemeinerungen, die bei strengen Brechtianern nicht nur Zustimmung auslösten. Von da ausgehend erarbeitete er sich ein Konzept der deutschen Literatur im 20. Jahrhundert, das dogmatischen Scharfrichtern lange Zeit ein Dorn im Auge war und sich besonders in seinem umstrittenen Buch «Krisen und Wandlungen der deutschen Literatur von Wedekind bis Feuchtwanger» (1966) und den entsprechenden Bänden einer umfassenden Geschichte der deutschen Literatur niederschlug.
Die Dichter der Vergangenheit aber betrachtete er immer in Einheit und Wechselwirkung mit den aktuellen literarischen Prozessen. In einem «Versuch über das Erbe» (1980) hat er das auch theoretisch begründet. Der Literaturkritiker Hans Kaufmann war geachtet und wirksam, nicht wenige Schriftsteller konnte er zu seinen Freunden zählen.
Als Hochschullehrer war er in Berlin und Jena tätig, später am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Es bildete sich um ihn ein Kreis von Schülerinnen und Schülern, die auch in den Zeiten seiner langwierigen Krankheit immer wieder Rat bei ihm einholten. Die Schließung der Akademie nach der Wende war ein bitter empfundener Einschnitt in seinem Leben.
Zwei Bilder von diesem Kollegen und Freund haben sich mir unauslöschlich eingeprägt. Zum einen der Student, der mit aufstehendem Haarwirbel und elastisch-energischem Schritt auf die Bühne stürmt, um zur Gitarre Brechts «Erinnerung an die Marie A.» anzustimmen, begeisterter Zustimmung seines Publikums gewiss. Zum anderen der von Jahrzehnte langer Krankheit Geplagte, der seinem mageren, geschundenen Körper mit höchster Anstrengung neue Texte abfor dert. Sie sind nun sein Vermächtnis.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.