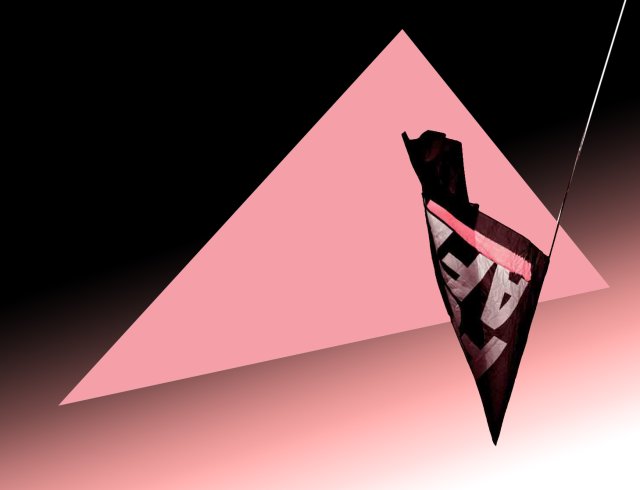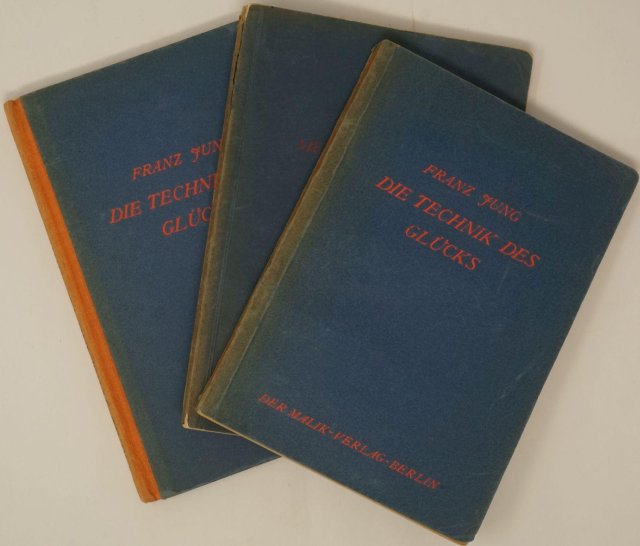- Kultur
- Reportage - Spitzbergen
Der nördlichste Blumenladen der Welt
Vom schlichten Bergbaudorf zum Forschungs- und Tourismuszentrum: Longyearbyen auf Spitzbergen ist heute eine moderne »Metropole« der Arktis
Longyearbyen, die größte Siedlung des Inselarchipels Svalbard, ist zugleich die nördlichste Stadt der Welt (78° nördliche Breite). Sie liegt im Westen der Insel Spitzbergen und weist für ihre nur 1800 Einwohner eine erstaunliche Infrastruktur auf: Flughafen, Kohlekraftwerk, Verwaltungsapparat, Schule, Kindergarten, Kirche, Supermarkt, Kaffeehäuser, Restaurants, Blumenladen(!), Universität ... Ein Ort mit allem drum und dran sozusagen.
Rundherum herrscht hingegen pure Wildnis. Keine Straßen, keine Nachbarorte, nur riesige Gletscher, baumlose Steinwüsten und eine schneebedeckte Landschaft, durch die der König der Arktis streift. Manchmal kommen die Eisbären sogar bis nach Long-yearbyen, vor allem in der finsteren Jahreszeit. Deshalb sollte man immer mit offenen Augen durch die Polarnacht gehen!
Aber wer sind diese Leute, die jedes Jahr mit dreieinhalb Monaten Finsternis und Wintertemperaturen von -20 bis -30° C fertig werden? Eine »Urbevölkerung« hat es auf Spitzbergen nie gegeben. Anfang des 20. Jahrhunderts begann der US-Amerikaner Mr. Longyear mit seiner Gesellschaft Steinkohle abzubauen, bis 1916 die Norweger den Bergbau übernahmen. Die vorwiegend skandinavischen Arbeiter waren auf engem Raum in Baracken untergebracht, litten unter schlechten Arbeitsbedingungen und »Frauenmangel«. Fotos, die miteinander tanzende Männer zeigen, belustigen heute die Besucher des kleinen Museums. Freia Hutzschenreuter, eine der ersten Frauen auf Spitzbergen und heute eine liebenswerte Rentnerin, erinnert sich: »Es gab ja keinen Flughafen. So konnte man nur mit dem Schiff nach Spitzbergen kommen. Und im Winter waren die Fjorde zugefroren, da kamen auch keine Schiffe. Im Frühling warteten wir dann immer sehnsüchtig auf das erste Schiff, das endlich wieder Proviantnachschub bringen würde.«
Erst in den 70er Jahren fand eine »Normalisierung«, ein Wandel der sozialen Struktur statt: Einfamilienhäuser wurden gebaut, und die Arbeiter wurden motiviert, ihre Familien mitzubringen. Langsam öffnete sich der Ort auch für Besucher, und die ersten privaten Unternehmen wurden gegründet.
Mobilität mit hohem Lebensstandard
Heute zeichnet sich das »moderne Longyearbyen« durch eine noch immer atypische Geschlechterverteilung mit 40 Prozent Frauenanteil, einen hohen Lebensstandard und eine starke Mobilität der vorwiegend norwegischen Bevölkerung aus. Im Durchschnitt wohnt man auf Spitzbergen nur vier Jahre, spart bei den niedrigen Svalbard-Steuern und kehrt investitionsfreudig aufs Festland zurück.
Immer noch arbeiten viele Leute - vorwiegend Männer - in den Kohlebergwerken, Forschung wird an der arktischen Universität betrieben und in zwei kurzen Perioden boomt der Tourismus. Auffallend sind die vielen Kinder, die man auf der kleinen Skipiste hinter der Schule mit Schlitten und Snowboards oder beim eifrigen Graben von Schneehöhlen antrifft. Sie sind Arktis-Experten, lernen sie doch von klein auf, wie man Erfrierungen vorbeugt, ein Notlager errichtet und Eisbärenkontakt vermeidet. Der Schweizer Kindergärtner Hans Zellweger erzählt: »Gefährlich ist der Wind, da muss man die Kleinen warm einpacken - Pelz ums Gesicht herum, damit sie keine Erfrierungen bekommen.«
Roger Daniloff, heute einer der 200 Studierenden an der Arktis-Universität im Ort, erinnert sich: »Als Kind war ich im Winter immer viel draußen. Ich konnte mit den Skiern zur Schule fahren, und am Wochenende hat mein Vater mit mir Ausflüge mit dem Schneemobil unternommen!«
Die Lehrerin Karin Kingswick Jusnes weiß ebenfalls genau, weshalb den Kindern in der dunklen Zeit nie langweilig wird: »Die meisten Hausaufgaben bekommen die Kinder im Winter. Und müder sind sie auch - sie schlafen mehr.«
In 60 Kilometer Entfernung gibt es eine zweite Schule - in der russischen Siedlung Barentsburg. Rund 800 Russen bevölkern den Ort, die meisten arbeiten im Kohlebergbau. Eingemummelt in dicke Pelzmäntel und mit Fellmützen auf dem Kopf huschen zwei hagere Gestalten über das holprige Pflaster. Barentsburg ist das Gegenstück zu Longyearbyen: Farbe blättert von den Häusern, Seemöwen nisten in kaputten Fenstern, auch die Lenin-Statue auf dem Hauptplatz präsentiert sich nicht im besten Zustand. Investiert wurde in den Ort schon lange nichts mehr. Es scheint, als sei der Kohlebergbau nur Beschäftigungspolitik und Rechtfertigung für die russische Anwesenheit auf Spitzbergen.
Die Norweger haben im Gegensatz dazu Kohle auch im umgangssprachlichen Sinn. In Longyearbyen wird investiert und gebaut. Ein riesiger Forschungspark und etliche neue Wohnhäuser wurden vor kurzem fertig gestellt. Die Bevölkerung wächst, Baugrund wird bereits knapp. Als nächstes soll der Flughafen ausgebaut werden, und im Zentrum der Stadt entsteht ein Kulturhaus mit Kino. Fast zu viel des Guten für nur 1800 Einwohner. Auch Norwegen will eben seine Präsenz zeigen.
Und wer regiert das Land? Sind es die Norweger oder die Russen? Seit dem 16. Jahrhundert beteiligten sich auf Svalbard viele Nationen am Walfang, an der Pelztierjagd, an Forschung und Bergbau. Jahrelang geschah dies, ohne dass dieser Archipel zu einem bestimmten Staat gehört hätte - die Inselgruppe Svalbard war ein »Niemandsland«, Terra nullius. Es gab keine Gesetze oder Vorschriften und keine Gerichte, um Streit zu schlichten. Das funktionierte relativ gut, solange sich die Aktivitäten auf Walfang, Jagd und Forschung beschränkten. Das Land war groß, und die Konflikte waren klein.
Im frühen 20. Jahrhundert war es hauptsächlich der Bergbau, der eine Veränderung bewirkte. Gestritten wurde um Schürfrechte für bestimmte Gebiete, und Gesetze wurden notwendig. Nach vielen Verhandlungen kam es schließlich 1920 zur Unterzeichnung des »Svalbard-Vertrages«, bis heute von 41 Staaten. Norwegen bekam die Souveränität über die Inselgruppe zugesprochen und hat auch die natürlichen Ressourcen der Insel zu verwalten.
Manchmal kommt die Volkstanzgruppe
Viel Austausch findet zwischen den beiden Orten Barentsburg und Longyearbyen nicht statt. Hie und da ein sportlicher Wettkampf, und manchmal kommt die russische Volkstanzgruppe in dem norwegischen Ort vorbeigeschneit. Eine Straßenverbindung, die für eine stärkere Zusammenarbeit förderlich wäre, gibt es nicht. Da Gletscher und Sümpfe auf der Strecke liegen, wäre sie wohl auch nicht möglich. So bleibt im Sommer bloß die Möglichkeit, mit dem Schiff von der einen zur anderen Siedlung zu gelangen. Im Winter oder im Frühling, wenn das Licht zurück ist, braust man mit Motorschlitten über Gletscher und gefrorene Sümpfe. Fast drei Monate lang ist diese Piste aus Eis und Schnee befahrbar - bevor sie schmilzt.
Jetzt - Anfang März - stehen Outdoor-Aktivitäten genau dieser Art auf dem Programm: Motorschlittenfahrten durch die verschneite Landschaft und über das dicke Eis der zugefrorenen Fjorde. Vor allem an den Wochenenden begibt sich Groß und Klein auf Ausflüge in die Wildnis. Die Ziele sind beeindruckende Gletscherfronten aus bläulich schimmerndem Eis, verlassene Bergbausiedlungen, bizarre Berglandschaften, alte Trapperhütten. Und so manch eine Familie aus Longyearbyen unternimmt einen Ausflug nach Barentsburg.
Dort gibt es ein russisches Hotel, in dem man übernachten und sich stärken kann. Auf den Tisch kommen Gulasch, eingelegtes Gemüse und natürlich Wodka. Es läuft russisches Fernsehen und an der Bar kann man kleine Matrjoschkas, Postkarten und Bier aus Russland erstehen. Abends, während die Sonne langsam untergeht, zieren schönste Pastellfarben den Himmel: Hellblau, Rosa und zartes Orange. Die weißen Berge heben sich klar von dem dunkler werdenden Hintergrund ab, bis auch sie aufhören zu leuchten. Die Nacht bricht herein, Sterne und vereinzelte Nordlichter sind zu sehen. Doch schon bald wird es die Dunkelheit nicht mehr geben, und die Sonne wird rund um die Uhr scheinen. Dann werden sowohl die russischen als auch die norwegischen Kinder nicht mehr so zeitig ins Bett wollen
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.