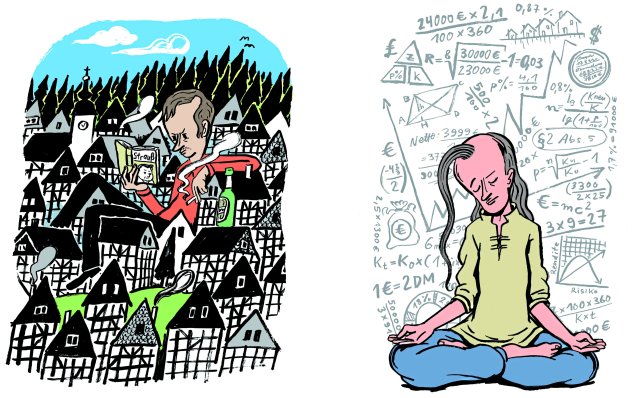Wieder kein Fußballspiel!
»Was vom Vorhang übrig bleibt« - die nd-Serie zur Bilanz der Theaterspielzeit 2015/16. Teil 4: Berliner Ensemble
Er bellt geradezu. Sehr heftig. Es ist Peter Handke, der da schimpfen lässt (im Stück »Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße«), und Hauptdarsteller Christoph Nell zetert, als tue er es im Auftrag von Claus Peymann: »Es ist eine Zeit, als wisse man, als wüsstet ihr alles vom anderen. Als sei lückenlos alles zu wissen. Und zugleich ist es eine Zeit, da man nichts mehr, gar nichts mehr weiß vom anderen, auch gar nichts mehr wissen will.«
Unsere Zeit. Zerrüttete Zeit. Anwurf und Spiel gegen sie - Peymanns Element. Zum Kampf rief er seit jeher die Mündigkeit, gesiegt hat wohl die Müdigkeit. 2017 wird das Theater am Schiffbauerdamm von Oliver Reese übernommen, dem jetzigen Chef des Schauspiels Frankfurt am Main. Das Berliner Ensemble leidet auf seine sehr eigene Weise daran, dass am Hause etwas zu Ende geht. Es geht schon länger zu Ende, als dieser Einschnitt bekannt wurde. Was zu Ende ist, das steht - was aber zu Ende geht, das immerhin bewegt sich. Ein Geher war und blieb Peymann nämlich immer, gerade auch als »Untergeher«, um einen Säulenheiligen zu zitieren: Thomas Bernhard - den der Wiener Dramaturgenkomödiant und Komödiantendramaturg Hermann Beil in immer neuen giftmelancholischen Lesevarianten im Repertoire des Spielplans hält.
Just dem Berliner Ensemble sieht man ganz besonders an, wie ein Schmerz öffentlich ausgetragen wird. Peymann hat nie aufgehört, sich mit Superlativen zu kostümieren, zu schützen, zu gefährden: tolles Ensemble, aufregendes Repertoire. Er ist geradezu wundenbesessen, keiner reißt so absichtsvoll bedenkenlos die Diskrepanzen auf zwischen Anspruch und Möglichkeit, zwischen betriebsamer Übertreibung des Konstrukts und dem Dahintreiben des laufenden Betriebs. Ob Ernst Toller, Samuel Beckett, Georg Büchner, William Shakespeare, Siegfried Lenz, es gibt ja nirgends etwas, das nicht längst auch, und sei es irgendwann gewesen, an anderen Bühnen gespielt wurde. Oder derzeit gespielt wird. Na und? Theater ist Wiederholungstäterschaft. Um schönste Freiheit kurzzeitig so weit zu übertreiben, dass wir etwas genießen, was wir sonst elend erleiden. Vor allem Ohnmacht.
Auch Nikolai Erdmans »Selbstmörder« lief vor Jahren bereits an der Volksbühne, wurde nun von Jean Bellorini am BE inszeniert. Selbstbestimmung und Fremdsteuerung - was Tragödienfutter ist, schmeckt auch als Schwank. Welch weise Wendung, dass an der Bühne des zähen wie zerzausten Zähnezeigers Peymann auch der vermeintlich kleinbürgerliche Weg als Emanzipation aufleuchten darf: »Unsern Aufbau, sämtliche Errungenschaften, Weltbrände, Eroberungen, das könnt ihr alles behalten. Gebt uns ein stilles Leben - und ein anständiges Gehalt. Erlaubt uns zu sagen, dass wir ein schweres Leben haben.«
Das BE tapferte sich durch die Monate: Besagter Weltveränderungsfuror ist irgendwie null und nichtig geworden; aber der Rumor darum blieb null und - wichtig. Das Programm lockte nicht gerade mit Erhitzungen, Handkes schwungvoll elegische Landstraßen-Laudatio (zauberzwinkernde Regie: Peymann) wurde von der Kritik ungerecht lustlos registriert, Fassbinders »Bremer Freiheit« und Ionescos »Die Stühle« freilich sorgten für Randglanz auf kleineren Spielflächen. Zu viel Wohltemperiertes? Das hat doch Bleiberecht wie andere (wenn man ihm Obergrenzen setzt)! Es hat sein Publikum, und was sollte man gegen eine Gemeinde einwenden, die ihrem Abonnement frönt und beglückt aufatmen darf, wenn Schulklassen kulturvoll gespannt sind oder wenigstens diszipliniert aushalten? Was im Falle von Leander Haußmanns unerwartet gleichförmiger Arbeit »Drei Schwestern« wahrlich als Leistung gelten muss.
Im Gegensatz zu seiner treibenden, taffen, trotzig trötenden Inszenierung »Die Räuber«. Schiller als Konter gegen eine Klassik, die falsche Ideale feiert. Edle Räuber? Die Lüge liegt hinter uns. Wir sind nicht weiter. Wir sind nur später. Unser Bewusstsein ist montiert aus konkurrierenden Jargons. Ostwestjargon, Linksrechtsjargon, Jargons für Fitness, Parteien und das Jenseits. Was wir denken, wie wir urteilen, das scheint mehr und mehr davon abzuhängen, welchem Jargon wir am meisten ausgeliefert sind. Und selber ausliefern. Jargon, das ist angewandte Sprache: Sag mir, wo du stehst. Grauenhaft. Als ließe sich Welt (noch immer) auf Bewusstsein reimen.
Da empfahl sich Leander Haußmann trefflich: Theater wie ein trotzig schönes Asyl, das alles sein darf, aber sich nicht in dem erschöpfen möge, was man noch immer denkfaul eine gute, große Sache nennt. Haußmann inszenierte einen Abschiedsbrief Peymanns - man muss die Tragödien nur richtig lesen wollen. Deren größte übrigens nach wie vor darin besteht, dass des Hausherrn unglücklichster, jahrzehntealter Traum auch in dieser Spielzeit unerfüllt blieb: ein Fußballspiel live auf der Bühne zu inszenieren.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.