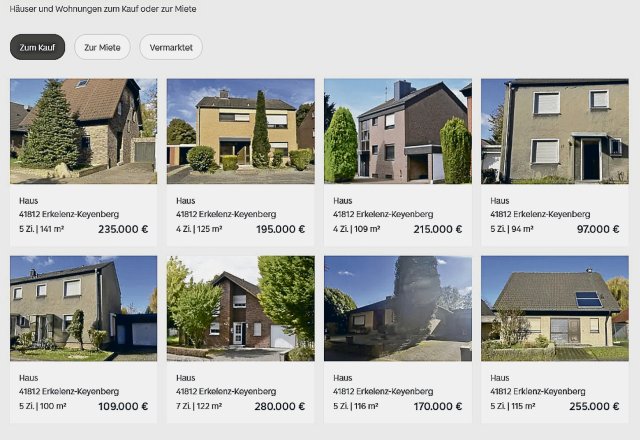Ein Leben in ständiger Angst vor Abschiebung
Angesichts der drohenden Rückführungen politisieren sich die Gemeinden der Hindus und Sikhs in Deutschland
Der Sikh-Tempel, Gurdwara genannt, wirkt unscheinbar. Er reiht sich unauffällig ein neben die anderen Bürogebäude in der Borsigallee im Frankfurter Osten. Eine Gruppe von Frauen in Salwar Kameez, der traditionellen Kleidung muslimischer Inder, betritt den Eingang. Es ertönt eine Stimme, die das ganze Haus beschallt. Ruhig klingt sie, als würde jemand etwas erklären. Aber laut genug, damit niemand ein Wort verpasst. Sie kommt aus dem Gebetsraum. Hier haben mehrere Hundert Menschen Platz, sie sitzen auf dem Boden und hören den Priester aus dem heiligen Buch - Guru Granth Sahib - rezitieren. Auf Punjabi erklärt er der Gemeinde die rezitierten Stellen.
Ein Stockwerk darüber ist fast genauso viel los. Doch hier wird nicht gebetet, sondern gearbeitet. Hinter einer Tür hat sich eine Gruppe junger Erwachsener versammelt. Sie sprechen abwechselnd auf Deutsch, Kabli und Multani, ihren Muttersprachen, die dem Punjabi nicht unähnlich sind. Sie sitzen im Kreis, in der Mitte befindet sich ein Stapel mit Papieren. Darauf zu lesen: Namen, Adressen. Es sind persönliche Dokumente, die von den Jugendlichen in zwei Kategorien eingeteilt werden: in sogenannte »kritische« und »unkritische« Fälle, wie sie es nennen. Die »kritischen Fälle« sind unmittelbar von einer Abschiebung betroffen, die »unkritischen« vermutlich nicht. Sogleich merkt man: Das Gurdwara, dieser religiöse Ort, er ist in diesen Tagen auch ein politischer Raum.
Kein Wunder, denn die Hindus und Sikhs stehen im Moment besonders im Fokus der Politik. Sie sind von Abschiebung bedroht, nach Afghanistan, ins seit vielen Jahren umkämpfte Kriegs- und Krisengebiet. In ein Land, in dem sie verfolgt und bedroht werden. Entsprechend groß ist die Angst in der Gemeinde. Auch bei Jiwarn Singh. Der 64-Jährige verließ erst vor einem Jahr Afghanistan. Derzeit hat er ein sechsmonatiges Visum. Bald muss er wieder zum Amt und wird sehen, wie über das Schicksal seiner Familie entschieden wurde. Jiwarn Singh trägt einen Turban, er hat einen weißen Vollbart und wirkt freundlich. Er möchte anonym bleiben. Falls er nämlich abgeschoben wird, ist die Angst, von den Taliban erkannt zu werden, groß.
»Afghanistan war mal ein Land für Hindus und Sikhs«, betont Singh. Seine Augen leuchten, wenn er von der Zeit erzählt, als Mohammed Daoud Khan der erste Präsident der Republik Afghanistan war, von 1973 bis zu seinem Tod 1978. Daoud, so Singh, habe das Land vorangebracht. Hindus und Sikhs hätten viele Geschäfte besessen und allerlei verkauft: trockene Früchte, Stoffe und Schmuck. »Aber die Zeiten haben sich geändert, Hindus und Sikhs können heute unmöglich dort leben«, fährt er fort. Nach der sowjetischen Intervention unter dem Präsidenten Babrak Karmal, der zwischen 1979 und 1986 als Präsident amtierte, sei ein Zusammenleben mit der übrigen Bevölkerung schwer gewesen. In den öffentlichen Schulen sei es täglich zu Übergriffen gekommen. Die Mädchen seien belästigt, die Jungs geschlagen worden.
Auch heute machen die Anschläge, über die in den Massenmedien berichtet wird, nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Zahl der Übergriffe aus. Vieles bleibt im Dunkeln. Zum Beispiel, dass regelmäßig Mitglieder aus der Gemeinde entführt und in die Berge verschleppt wurden, um Lösegeld von der Familie zu erpressen. »Die Familien bezahlen dann eine hohe Summe an Schutzgeldern«, berichtet Singh. Auch er selbst sei entführt worden und der Gefahr ausgesetzt, sein Leben zu verlieren. Weshalb er entschied, mit seiner Familie nach Europa zu kommen. Doch nun ist auch seine Zukunft wie die vieler anderer Afghanen ungewiss.
Allerdings formiert sich Gegenwehr: Bereits mehrere Demonstrationen hat es gegen die Sammelabschiebungen gegeben. Zur ersten Demo im Dezember, als am selben Abend das erste Flugzeug mit Dutzenden Geflüchteten in Richtung Kabul abhob, kamen bereits mehrere Hundert Menschen. Anfang Januar in der Frankfurter Innenstadt waren es dann sogar mehr als 1500 Demonstranten, die ihren Unmut über die Politik der Bundesregierung zum Ausdruck brachten. Gleichzeitig gingen in Hamburg rund 800 Menschen auf die Straße.
Unter den Frankfurter Demonstranten befand sich auch Zail Sani, der zweite Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Kulturvereins der afghanischen Hindus und Sikhs, der maßgeblich in die Organisation der Proteste eingebunden ist. »Wir wollen die deutsche Bevölkerung und die Medien auf uns aufmerksam machen«, sagt Sani. Der Verein hat bereits Kontakt zu Anwälten aufgenommen, um weitere Abschiebungen über gerichtliche Instanzen zu verhindern.
Unterstützung bekommen die afghanischen Hindus und Sikhs dabei von der LINKEN. So war die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler bei den Frankfurter Demos dabei. Es ist eine ganz neue Symbiose: auf der einen Seite die bislang wenig politischen Hindus und Sikhs, auf der anderen Seite die eher religionsferne Linkspartei. Auch Zail Sani würde sich eher nicht als »links« bezeichnen, ist jedoch froh, »dass die Linkspartei uns unterstützt. Auch wenn wir die Politik aus unserem Verein eigentlich heraushalten wollen«.
Doch unpolitisch zu sein, das geht in diesen Tagen nicht mehr. Deshalb sucht der Verein nun weiter nach Bündnispartnern, vor allem auf Parteiebene. Ein schwieriges Unterfangen, unterstützen doch die meisten Parteien die Abschiebepolitik der Bundesregierung. Auch die Grünen treten weitestgehend dafür ein.
Umso notwendiger erscheint aus Sicht der Hindus und Sikhs daher die Intensivierung der eigenen politischen Arbeit. Denn eines ist sicher: Es werden weitere Sammelabschiebungen folgen. Jiwar Singh fürchtet, bald auch unter den Unglücklichen zu sein, die zurück nach Kabul müssen. »Ich habe noch keinen Brief bekommen, aber ich habe Angst«, sagt er. Und schiebt dann diesen Satz hinterher: »Bevor ich abgeschoben werde, bevor ich gezwungen werde, meinen Glauben zu leugnen und zusehen muss, wie meiner Frau und meiner Tochter Schreckliches widerfährt, sollen die Behörden mir das Leben hier nehmen.«
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.