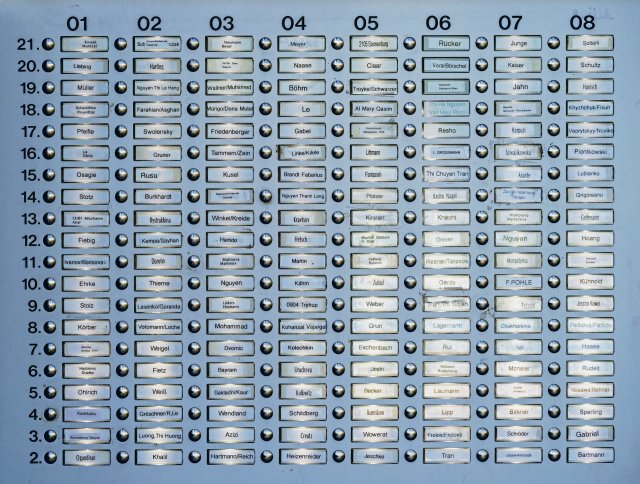- Wirtschaft und Umwelt
- Kapitalismus in der Krise
Die nächste Finanzkrise kommt bestimmt
Analysten sehen wegen hoher Schulden und des Aufstiegs von Rechtspopulisten die Stabilität bedroht
Die Deutsche Bank warnt vor einem bevorstehenden Schock im Weltfinanzsystem. Ökonomen der Bank um Jim Reid, der für die Strategie im globalen Kreditgeschäft zuständig ist, haben sich mit der heiklen Frage beschäftigt, ob der Welt schon bald wieder eine Finanzkrise bevorsteht. Ihre pessimistische Antwort: In den kommenden zwei Jahren drohe wahrscheinlich ein schwerer Schock.
Reid und seine Kollegen ziehen ihren Pessimismus zunächst aus dem historischen Rückblick. Seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems stabiler Wechselkurse habe die Frequenz der Krisen zugenommen. Ihre Beispiele reichen von der britischen Bankenkrise 1975 über die beiden Ölschocks, Staatspleiten von Schwellenländern in den 1980ern, das Platzen von Japans Immobilienblase, die mexikanische »Tequila-Krise«, die Asien- und Russland-Krise Ende der 1990er Jahre und den Dotcom-Crash 2000 bis hin zur Weltfinanzkrise ab 2007 und der Staatsschuldenkrise in der Eurozone. Vor diesem Hintergrund gehöre schon viel Optimismus dazu, das Finanzsystem nun für dauerhaft stabilisiert zu halten.
Aus früheren Erfahrungen leiten die Ökonomen »Koinzidenzen« ab, also Situationen, die häufig im Zusammenhang mit Krisen auftauchen. Dazu zählen außergewöhnlich hohe Schulden in der Gesellschaft und hohe staatliche Budgetdefizite. Aktuell warnen Jim Reid, Nick Burns, Sukanto Chanda und Craig Nicol vor »einer Reihe von Feldern im globalen Finanzsystem, die auf einem extremen Level sind«.
Drei Faktoren nehmen die Autoren der Analyse »Die nächste Finanzkrise« besonders unter die Lupe. Erstens den auffällig hohen Stand von Vermögenspreisen in aller Welt - gemeint sind vor allem die für Aktien und Häuser. Beunruhigend finden die Analysten zweitens auch die großen Schuldenberge von Staaten und in vielen Ländern von Privathaushalten. Ungewöhnlich ist der dritte Frühindikator, den Reid und Kollegen nutzen: den politischen Aufwind für »populists«, denn diese könnten »das ganze Spiel ändern« und die Stabilität gefährden. Die politischen Erfolge rechtsnationalistischer Parteien wie zuletzt der AfD in Deutschland beunruhigen auch Manager von Investmentfonds wie Thierry Bogaty von Europas größtem Vermögensverwalter Amundi. Auf die wachsende Verunsicherung weiter Bevölkerungskreise durch die Globalisierung müsse die Finanzbranche reagieren, etwa durch nachhaltige Investitionen, so seine Botschaft.
Der historische Bogen, den die Deutsche-Bank-Studie schlägt, beginnt nicht zufällig mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems - dies habe seit 1971 das System krisenanfälliger gemacht. Der Regimewechsel hin zu freien Wechselkursen habe aber auch mehr Möglichkeiten geschaffen, auf Krisen zu reagieren.
So fluten die Zentralbanken seit 2007 die Märkte mit Geld wie noch nie, um das Finanzsystem zu stabilisieren - und stehen nun vor dem neuartigen Problem, ihre aufgeblähten Bilanzen wieder zu schrumpfen. Gleichzeitig erfordern beispielsweise die Ungleichgewichte im Welthandel laufend große Kapitalflüsse, um das Weltfinanzsystem stabil zu halten, so die Deutsche Bank. All das geschehe in Zeiten mit historisch niedrigen Zinsen, mit extrem hohen Vermögenspreisen und einem immer noch sehr niedrigen Wachstum.
Auf ein weiteres Ungleichgewicht weisen die Analysten von Ernst & Young hin. Die Top-10 der US-Banken konnten ihren Gewinn im ersten Halbjahr um fast ein Fünftel steigern, die zehn größten europäischen Banken legten nur um fünf Prozent zu. Damit vergrößert sich der Abstand zwischen den Spitzeninstituten in Europa und den USA weiter: Die Eigenkapitalrentabilität der europäischen Spitzenreiter liegt bei 5,9 Prozent, die US-Banken kommen auf 10,6 Prozent - »sie wirtschaften damit fast doppelt so profitabel wie die europäischen Wettbewerber«. Und die Aussichten für die europäischen Institute seien mau: Während in den USA die Deregulierungsoffensive der Trump-Administration ein kräftiges Gewinnplus verspreche, kämpften Europas Banken immer noch mit juristischen Altlasten, faulen Krediten und hohen Regulierungskosten. Dennoch streben die meisten EU-Banken eine Eigenkapitalrentabilität von 10 bis 12 Prozent an. Risiken sind da programmiert.
Weit weniger Aufmerksamkeit als Pessimisten wie Jim Reid erhalten derzeit die Optimisten in der Analystenzunft - wie die der Norddeutschen Landesbank: Der »enorme Eigenkapitalaufbau« infolge der stärkeren Regulierung der Banken (»Basel III«) dürfte in Europa weitgehend abgeschlossen sein, heißt es dort. Verbesserte Aussichten auf europäisches und globales Wirtschaftswachstum sowie das langsam steigende Zinsniveau stützten das operative Bankgeschäft.
In den kommenden Wochen wird sich das Gerangel unter den Bankökonomen noch zuspitzen. Die Herbsttagung des IWF im Oktober soll fast ganz im Zeichen eines Themas stehen: der Finanzmarktstabilität.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.