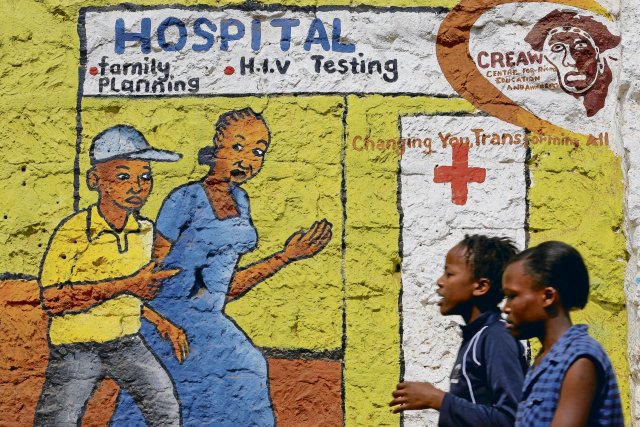- Wirtschaft und Umwelt
- Disability Studies
»Barrierefreiheit ist unsere Utopie«
Die Disability Studies in Hamburg und NRW stehen – auch wegen ihrer Gesellschaftskritik – vor dem Aus

Wie kommt es, dass die Forschungsbereiche der Disability Studies in Hamburg und Köln gleichzeitig gefährdet sind?
Im Juni haben wir erfahren, dass das Zentrum für Disability Studies und Teilhabeforschung in Hamburg sowie die Internationale Forschungsstelle für Disability Studies in Köln von Kürzungen und Schließungen im Herbst bedroht sind. In beiden Fällen läuft es auf die sogenannte Knappheit an Haushaltsmitteln hinaus. Aber Mittel sind in Hülle und Fülle da, es kommt eben darauf an, wofür sie ausgegeben werden. Bei Disziplinen wie Disability Studies, Queer Studies oder Racial Studies gibt es derzeit einen Backlash. Rechte Medien und rechte Propagandisten möchten die Studien eindampfen. Es besteht eine gemeinsame Gefährdungslage für kritische emanzipatorische Wissenschaften.
Worin drückt sich denn die Gesellschaftskritik der Disability Studies aus?
Das Wort kommt aus dem englischsprachigen Raum, im Grunde genommen heißt es Behinderungsforschung. Sie kritisiert die herkömmliche gesellschaftliche Sicht auf Behinderung. Die wäre, dass eine Behinderung ein Defizit ist, das geheilt werden muss, indem sich das Individuum rehabilitiert. Das fängt im Kleinen an, also die Brille aufzusetzen, wenn die Augen nicht mehr so gut funktionieren, ein Hörgerät oder einen Blindenstock zu nutzen. Wir lehnen deshalb Blindenstöcke, Brillen oder Prothesen nicht ab. Das ist natürlich Quatsch. Aber wir definieren Behinderung als soziales und kulturelles Konstrukt.
Wie wir Behinderungen einschätzen, das hat mit gesellschaftlichen Realitäten zu tun und mit Realitäten, die im kulturellen Diskurs entstehen. Wenn es nicht überall Rampen und Aufzüge gibt, hat eine Person im Rollstuhl ein Problem. Zugleich wird sie gesellschaftlich als Person gesehen, die Probleme hat. Diesen Teufelskreis muss man durchbrechen, dafür fordern wir Barrierefreiheit. Das ist quasi unsere Utopie.
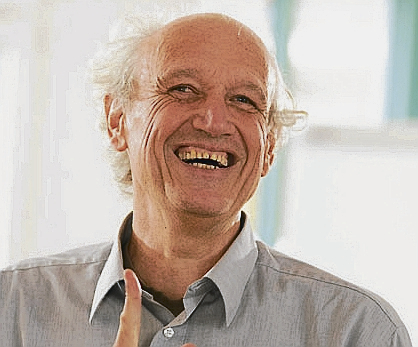
Siegfried Saerberg ist Professor für Disability Studies an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie. Die Hochschule ist in Trägerschaft der Stiftung »Das Rauhe Haus« in Hamburg. Derzeit ist die Disziplin in Deutschland von Kürzungen und Schließungen bedroht.
Sie arbeiten auch mit eigenen Erfahrungswerten?
Für uns ist partizipatives Forschen elementar. Das heißt erstens, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen forschen und sie den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit erhalten. Zweitens bringt dieses Konzept neue Wissensbestände in den Forschungsprozess. Manche Barrieren bemerken Menschen ohne Behinderung nicht, weil sie nicht so auffällig sind wie ein fehlender Lift.
Und was haben Rechte dagegen?
Etwas vereinfachend: Wenn Barrierefreiheit komplett wird, dann muss sich vieles in unserer Gesellschaft und Kultur ändern. Dadurch werden gewohnte Muster über den Haufen geworfen. Plötzlich gründen Menschen mit Behinderung Familien, sind Konkurrent*innen auf dem Arbeitsmarkt, wollen mitreden und mitbestimmen. Vielleicht fordern sie sogar eine Kultur mit ganz flachen Hierarchien. Da bekommen es Menschen, die stark an althergebrachte Werte gebunden sind, schnell mit der Angst zu tun.
Sie sagen, Mittel für inklusive Bildung scheinen derzeit knapp. Die Themen Inklusion und Teilhabe ziehen sich aber durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, und Bildung und Forschung sind demnach »der Schlüssel für die Zukunft unseres Landes« …
Sich für Inklusionen auszusprechen, klingt immer schön. Zwischen Anspruch, beziehungsweise dem Vorgeblichen, und der Realität ist aber oft eine Lücke. Wenn derlei im Koalitionsvertrag steht, ist das trotzdem gut. Man kann dann die Regierung darauf aufmerksam machen, wenn sie nicht dementsprechend handelt. Das machen wir. Die Disability Studies beziehen sich schließlich auch auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und überwachen deren Umsetzung. Umgekehrt waren sie übrigens auch jahrzehntelang ein Motor für die UN-Behindertenrechtskonvention, die Anfang der 2000er ins Rollen kam. Das ist mir wichtig, weil auch Menschen in der Behindertenbewegung Disability Studies manchmal als eine Art akademische, exotische Pflanze sehen und nicht wissen, was sie damit zu tun haben sollen.
Stichwort Feigenblatt …
Genau. Aber, um im Bild zu bleiben: Aus den Hochschulen wächst diese Pflanze heraus, von deren Früchten viele Menschen mit Behinderung dann kosten können. Die Disability Studies haben das neue Denken über Behinderung mit hervorgebracht. Sie haben Vorläufer in der Antipsychatriebewegung der 60er Jahre, in der Bürgerrechtsbewegung in den USA und linken sozialistischen Kräften in Großbritannien in den 70er Jahren.
Ist das Ihr Argument für die Förderung der Disziplin? Die Umsetzung vieler inklusiver Vorhaben liegt schließlich in den Händen der Kommunen, die konstant über Unterfinanzierung klagen.
Ja. Und wir sind eine ganz eigene, kritische Dimension, die sehr grundlagenorientiert ist. Wir reflektieren auf Kultur und Gesellschaft sozusagen vom Rand her. Aus der Randständigkeit, der peripheren Situation heraus fallen uns viele Dinge eher auf als anderen, die in ihren Denkkategorien gefangen sind. Diese kritische körperliche, emotionale und kognitive Distanz nehmen behinderte Forscherinnen ein und stellen zum Beispiel fest, wie wahnsinnig stark gesellschaftliche Normalitätskonzepte an Ableismus orientiert sind. Daraus entstehen neue Möglichkeiten, die Welt zu denken.
Disability Studies sind weit mehr als eine Hilfsdisziplin für Soziale Arbeit oder Sonderpädagogik, wie sie in Deutschland manchmal verkürzt wahrgenommen werden. Sie sind eine gewagte kritische und kreative Zukunftswissenschaft.
Um die Disziplin in Hamburg und Köln zu erhalten, gibt es nun eine Petition. Wie ist der aktuelle Stand?
Seit wir im Juni von den drohenden Kürzungen erfahren haben, organisieren wir Widerstand. Wir fallen dadurch nicht von der Spitze des Elfenbeinturms auf den Boden – weder in Hamburg noch in Köln waren wir so richtig etabliert. Aber wir haben uns bisher am Leben gehalten. Ich habe die Professur in Hamburg inne. In Köln konnte man sogar mit einem Thema der Disability Studies promovieren. Als Fach konnte man sie aber nicht studieren, sodass es nicht möglich gewesen wäre, dort einen Bachelor oder Master zu machen. Wir verbinden also unseren Überlebenskampf mit dem Appell, die Disability Studies endlich zu institutionalisieren. Wenn jetzt aber an dem wenigen, was es in der Disziplin in Deutschland gibt, gespart wird, gleicht das einer Ausrottung des gesamten Bereichs.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.