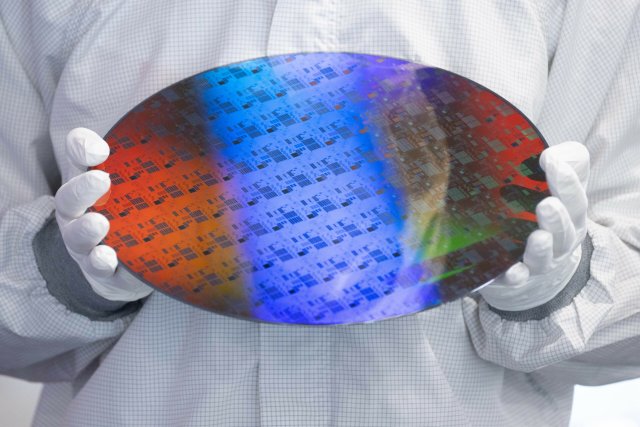Wissenschaft im Krisenmodus
Ethiker befürchten Aufweichungen wissenschaftlicher Standards bei schneller Suche nach Therapien
Derzeit sind Mediziner praktisch allgegenwärtig in den Medien. Und wie kaum je zuvor hat man den Eindruck, dass die Politik mehr auf wissenschaftliche Expertise als auf ihre Klientel hört. Damit verbunden sind extreme Erwartungen an die Forschung: eine effektive Impfung gegen den Erreger Sars-CoV-2, wirksame Medikamente für die Behandlung bereits Erkrankter ...
Eine solche gesellschaftliche Situation bleibt nicht ohne Folgen für den Wissenschaftsbetrieb. Während viele Labors derzeit wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen sind, herrscht bei der Coronavirus-Forschung Hochbetrieb. Als Journalist wird man von einer Flut neuer Veröffentlichungen bedrängt, deren Erkenntniswert zuweilen schwer einschätzbar ist. Zumal, anders als bei bisherigen Grippepandemien oder den beiden früheren Corona-Infektionen Sars und Mers, inzwischen auch in der Medizin viele Arbeiten auf sogenannten Preprint-Servern online veröffentlicht werden, bevor sie für den Druck in Wissenschaftszeitschriften durch Fachkollegen begutachtet wurden. So finden sich derzeit zu dem Suchbegriff »Covid-19« 6519 Publikationen aus Fachmedien bei der Medizindatenbank PubMed und weitere 2315 in den beiden Preprint-Portalen medRxiv und bioRxiv.
In normalen Zeiten würden viele dieser Veröffentlichungen ihren Weg in die Medien oder in den politischen Entscheidungsprozess gar nicht erst schaffen, weil sie von Fachkollegen analysiert und für mangelhaft befunden worden wären. In der aktuellen Krise allerdings finden auch zweifelhafte Studien schnell einen Weg in die Öffentlichkeit. Zudem werden Untersuchungen, die nur einen bestimmten Fachaspekt im Blick haben, zuweilen unangemessen verallgemeinert. So wurden etwa aus einer vorab veröffentlichten Windkanal- Untersuchung zur Verbreitung der Tröpfchen aus dem Atem beim Joggen oder Radfahren in Medien gleich weitreichende Schlüsse auf die Abstandsregelungen beim Sport gezogen, obwohl kein Virologe sich festlegen mochte, wieweit Viren in den Tröpfchen noch infektiös sind.
Ist dieser Aspekt eher eine Frage der Medien und ihrer Wissenschaftskompetenz, so hat offenbar auch der Wissenschaftsbetrieb selbst hier ein Problem. Die zwei Medizinethiker Alex John London von der Carnegie Mellon University in Pittsburg (USA) und Jonathan Kimmelman von der McGill University Montreal (Kanada) jedenfalls schreiben im US-Fachjournal »Science«, dass diese Drucksituation die Gefahr nachlassender wissenschaftlicher Qualität vor allem bei klinischer Forschung mit sich bringen könne. So würden derzeit in Nordamerika zahllose klinische Versuche mit ähnlichen Fragestellungen unternommen, so dass Ressourcen in unnützer Doppelforschung verschwendet werden. Gleichzeitig würden bei klinischen Studien einzelne Vorstufen übersprungen, in denen normalerweise erst einmal die Sicherheit des jeweiligen Wirk- oder Impfstoffs geprüft wird. Viele Studien seien zudem mangelhaft konzipiert und ausgeführt.
Als Beispiel führen die beiden Autoren auf, dass in Nordamerika allein 18 klinische Studien mit 75 000 Patienten zur Wirksamkeit des Malariamedikaments Hydroxychloroquin registriert wurden. US-Präsident Donald Trump und sein französischer Kollege Emmanuel Macron hatten frühzeitig auf dieses Medikament gesetzt, das bei dem Sars-Ausbruch 2002/2003 in Zellkulturen die Virusvermehrung hemmen konnte. Inzwischen ist einigermaßen sicher, dass dieses Medikament das Risiko ernsthafter Herzrhythmusstörungen mit sich bringt. Überdies wirkt es im realen Einsatz offenbar nicht, wie die wenig erfolgreiche Behandlung von mehr als 300 Covid-19-erkrankten Kriegsveteranen in den USA zeigte.
Ein weiteres Problem, das London und Kimmelman in der aktuellen Situation vor allem den Vorabveröffentlichungen anlasten, dürfte ein generelles Problem medizinischer Veröffentlichungen zu Arzneimittelwirkstoffen sein: das Übergewicht von Veröffentlichungen, die den Erfolg der Behandlung mit dem jeweiligen Wirkstoff belegen. Das jedenfalls meint Bernd Pulverer, Chefredakteur des von der European Molecular Biology Organization in Heidelberg herausgegebenen »EMBO Journal«. Pulverer fordert deshalb, »dass klinische Studien normalerweise registriert und unabhängig vom Resultat - das heißt, auch bei einem negativen Ergebnis - veröffentlicht werden müssen«. Er sieht hier auch die Wissenschaftsförderung in der Verantwortung.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.