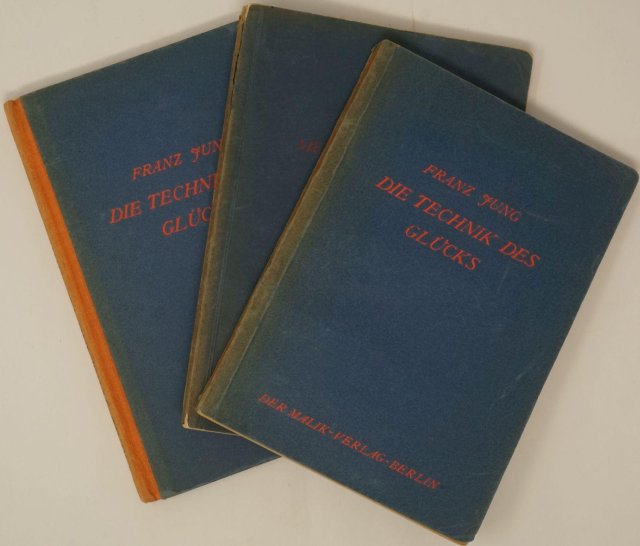- Kultur
- Reportage - Bolivien
Als »Gringos« in Bolivien unterwegs
Beobachtungen auf einer Fahrt durch das erwachende Indio-Land

»Gringos, Gringos«, ruft die Verkäuferin auf dem Markt der Siedlung Chaya Mayor in der Nähe der einstigen »Silberstadt« Potosi, als sie Fremde aus dem Bus steigen sieht. An den aus Holzkisten gezimmerten Ständen werden Mützen aus Alpakawolle, bunte Röcke, die traditionellen, hier vorwiegend von Frauen getragenen Hüte sowie Obst und Gemüse feilgeboten. Gringo? Wir haben die Bezeichnung als deftiges Schimpfwort in Erinnerung. Sollten wir im Bolivien unter dem ersten Indio-Präsidenten Evo Morales, der der ethnischen Gruppe der Aymara angehört, nicht willkommen sein? Ein mitreisender Experte klärt uns auf: »Gringo heißt nichts anderes als Ausländer. Erst in Verbindung mit der Bezeichnung Yankee für US-Amerikaner wird es zum Schimpfwort.« Die Verkäuferin hat also lediglich ihren Kolleginnen an den anderen Ständen die Ankunft hier eher seltener ausländischer Kunden gemeldet.
Raub von Gold, Silber und Zinn
Verwunderlich wäre freilich nicht, wenn Weiße in Bolivien mit Reserviertheit empfangen werden würden. Gerade jährte sich zum 515. Mal der Tag der »Entdeckung« des Kontinents durch Christoph Kolumbus. Während das historische Ereignis in den USA nach wie vor als »Columbus Day« gefeiert wird, sehen die immer stärker werdenden indigenen Bewegungen in Lateinamerika keinen Grund, die brutale Kolonisierung ihrer Heimat durch die Spanier nachträglich zu bejubeln. Die Indianer verloren alles. Die Konquistadoren rissen das Land an sich, raubten Gold und Silber und Zinn, zerstörten die Natur, unterjochten die indigenen Völker, nahmen ihnen ihre kulturelle Identität, dezimierten sie durch eingeschleppte Krankheiten und Kriege. Und sie etablierten die teils noch heute bestehende soziale Hierarchie: Als am »wertvollsten« galten die Spanier, deshalb waren ihnen alle Führungsposten vorbehalten. Es folgten deren in Südamerika geborene Abkömmlinge, die damals allerdings als Menschen 2. Klasse behandelten Kreolen, heute überwiegend zur Oberschicht gehörend. Als nächste die Mestizen oder Cholos (Mischlinge) und ganz unten die Indios. »Noch heute halten sie uns für Tiere, für Hunde. Wir kämpfen dafür, endlich als Bürger mit gleichen Rechten respektiert zu werden«, erklärt dazu der bolivianische Indio-Führer Wilber Flores. Erst 1953 wurden die Indianer Boliviens überhaupt gesetzlich als Staatsbürger anerkannt.
Vor diesem Hintergrund war es kein Zufall, dass Evo Morales um das Kolumbus-Jubiläum herum einen internationalen Kongress von Urvölkern in Chapare durchführen ließ. Dessen Abschlusserklärung verlangte den Schutz der Menschenrechte sowie der natürlichen Ressourcen von 370 Millionen Indigenen. »Indigene Gemeinschaften wissen, in Harmonie mit Mutter Erde zu leben. Das ist der Unterschied zwischen uns, Europa und den USA«, äußerte Morales.
Auf ein Anzeichen des wiedererwachenden Indio-Selbstbewusstseins stoßen wir später in Potosi vor der katholischen San-Lorenzo-Kathedrale. Deren Fassade fasziniert, nicht nur weil sie im »Mestizenbarock« gestaltet wurde, sondern auch weil neben christlichen Heiligen die Indio-Symbole Sonne und Mond dargestellt sind. Aber der indianische Priester der Kathedrale verwehrt ausländischen Besuchern den Zutritt. Dieser sei ein Sympathisant des Präsidenten, erfahren wir von einem Passanten. Und Morales befürworte eine stärkere Besinnung auf die uralte Naturreligion. Immerhin hätten die spanischen Missionare ja schon vor Jahrhunderten nicht verhindern können, dass die christianisierten Indios Maria mit der Pacha Mama, Mutter Erde, gleichsetzten. Bis heute gingen viele Bolivianer zwar zur Andacht in die Kirche, beteten zu Hause aber zur Pacha Mama.
Über hunderte Kilometer fahren wir auf dem Altiplano, der kargen Hochebene 3500 Meter über dem Meeresspiegel. Vorbei geht es an Lama- und Alpakaherden, an aus Lehmziegeln errichteten und mit dem harten Ichu-Gras gedeckten Hütten. Riesige Säulenkakteen säumen die Schotterpiste. Hier oben verlief einst von Potosi bis ins argentinische Salta die »Silberstraße«, auf der die Eroberer das begehrte Metall wegschafften. In einer Senke verläuft ein Stück des alten Inka-Pfades. Auf ihm liefen die »Chasquis«, die Nachrichtenboten. Alle 25 bis 30 Kilometer übermittelten sie an einem Wechselhäuschen mündlich ihre Botschaft, die so in »Windeseile« weitergetragen wurde. Chasquis durften als einzige neben dem Inka-Adel Kokablätter kauen.
Die Hoffnung richtet sich auf Evo Morales
Boliviens Straßenbild wird vom Indio-Element beherrscht. Immerhin sind 65 Prozent der etwa acht Millionen Landesbewohner Aymara und Ketschua. Und diese sowie ein paar andere, bedeutend kleinere ethnische Gruppen machen auch den Hauptteil der unter der Armutsgrenze lebenden rund 4,8 Millionen Bolivianer aus. Ihre Hoffnungen richten sich verständlicherweise auf »ihren« seit 2006 regierenden Präsidenten und dessen politische Partei MAS – die Bewegung zum Sozialismus. Die Losungen an Mauern und Wänden sprechen für sich: »MAS, Morales und wir sind das Volk«, »Evo gibt Bolivien die Würde zurück«, »Das Volk konstituiert sich« »Alphabetisierung! Evo Morales hält, was er verspricht«, »Lernen heißt wachsen«, »MAS ist die Volksmacht«. Dazu Che-Guevara-Graffiti mit den Wörtern »Chequito lebt«.
In der offiziellen Hauptstadt Sucre, benannt nach Marschall Antonio José de Sucre, einem Helden des Befreiungskampfes gegen die Spanier, werden wir Augenzeugen der erbitterten Attacken der hiesigen konservativen Elite gegen ein neues Bolivien. Sie steht im Bündnis mit der gesamten Oberschicht, mit Latifundisten, Minenbesitzern und Unternehmern. Sie alle wollen an den alten Machtstrukturen nicht rütteln lassen. Als Vorwand nehmen sie den alten Streit zwischen Sucre, unter den Indios Chuquisaca genannt, und der Metropole La Paz, wo sich der Sitz der Regierung und des Parlaments befindet. Sucre soll nicht länger nur symbolische Kapitale sein, sondern »komplette Hauptstadt« werden, wie Plakate und Transparente an jeder Ecke fordern.
Mehrere Wochen im September machten die »Capitalos« gemeinsam mit rebellierenden Studenten mobil. Unter Losungen wie »Sucre weiche keinen Schritt zurück, leiste Widerstand« sorgten sie für gewalttätige Aufmärsche, für Streiks und Kundgebungen, auf denen die Regierung als antidemokratisch diffamiert, ihr Kurs der Nationalisierung der Bodenschätze und der Förderung der Habenichtse verunglimpft, MAS-Anhänger übel beschimpft, Rufe nach Autonomie für die prosperierenden Departamentos, ja sogar nach Spaltung des Landes laut wurden. Wie eine Mahnung wirkte dabei die Inschrift am Giebel des Parlamentsgebäudes: »In der Einheit liegt die Kraft«. In La Paz geht man mit dem brisanten Hauptstadtthema weniger aufgeregt um. Auch hier Losungen: »Spielt Chuquisaca und La Paz nicht gegeneinander aus!« »In La Paz wird das neue Bolivien geboren« oder »Bolivien – Einheit in der Vielfalt«.
Auf der Fahrt von La Paz nach Coroico in die subtropische Yungas-Region beantwortet José, unser Begleiter, unsere Fragen, zum Beispiel nach der Popularität des Indio-Präsidenten. Die Ergebnisse der Meinungsumfragen zu seiner Politik schwankten zwischen 40 und 70 Prozent Zustimmung, sagt José. Nach seinen Erfahrungen sind die Umfrageresultate der katholischen Kirche am realistischsten. Sie bezieht durchaus Position zu aktuellen politischen Fragen, wie ein in der Peter-und-Paul-Kathedrale von Coroico ausgelegtes Flugblatt belegt. Es enthält eine Stellungnahme zur neuen Konstitution, über deren Ausarbeitung sich seit Monaten eine Verfassunggebende Versammlung in Sucre den Kopf zerbricht. Die katholische Kirche, so das Flugblatt, »hofft auf eine Verfassung, die menschliche Würde, Freiheit und soziale Gerechtigkeit garantiert und respektiert.« Und sie erwartet ein Dokument, in dem »das Recht auf religiöse Freiheit, auf Schutz der Ehe, Familie und Mutterschaft sowie das Recht auf Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod anerkannt werden.«
Kokatee auf der Getränkekarte
Bei einer Tasse belebenden Koka-tees, der in jedem Restaurant auf der Getränkekarte steht, kommt das Gespräch mit José zwangsläufig auf den Koka-Anbau, der seiner Meinung nach von Evo Morales, einst Gewerkschaftsführer der Kokabauern, weder gefördert noch gebremst wird. »Die Kokablätter,« erzählt er, »sind seit mindestens 4000 Jahren Teil der Indiokultur in den Anden, als Energiespender, als Medizin, als Mittel gegen Hunger, Kälte und Erschöpfung. Ohne dieses Elixier hätten die Indios gar nicht das Silber in den Minen von Potosi für die Spanier abbauen können.«
Zum Rohstoff für das Rauschgift wurde der harmlos aussehende Strauch erst, nachdem der Göttinger Albert Niemann 1860 aus den Blättern den Wirkstoff Kokain hergestellt hatte. Legal, weiß José, exportiert Bolivien 135 Tonnen Kokablätter jährlich für die Coke-Produktion in Nordamerika. Wie viele Tonnen illegal auf den globalen Markt gelangen, kann er nicht sagen. Aber er kennt die Preise für ein Kilo reines Kokain – in den USA bis zu 20 000 Dollar. Eine vernünftige Alternative zum Kokaanbau konnte den Bauern bislang niemand bieten. Die rigorose US-Antidrogenkampagne in den 1990er Jahren brachte nicht den gewünschten Erfolg, sondern steigerte nur den Hass auf die Yankee-Gringos. »Im Andengebiet wird es immer Koka geben«, ist sich unser Begleiter sicher, »selbst wenn man das Rauschgiftproblem in den Industriestaaten lösen sollte.«
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.