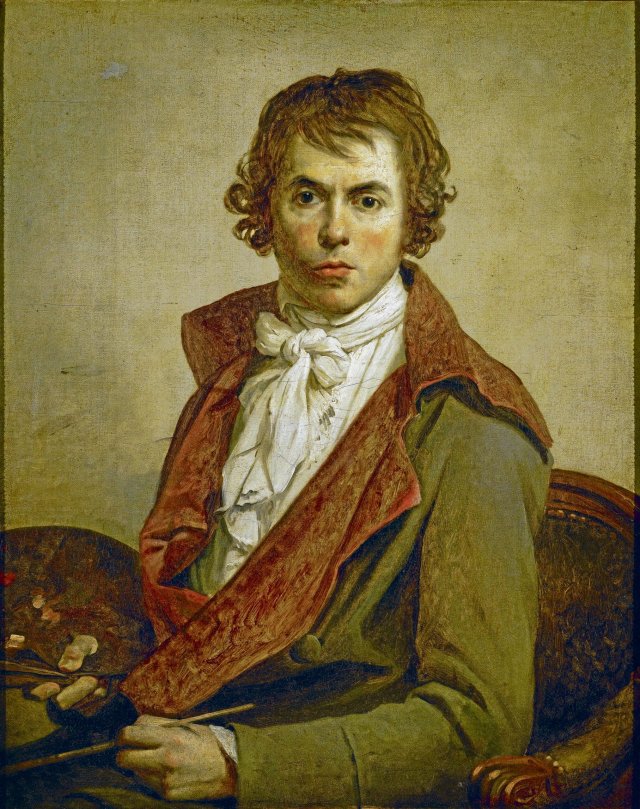- Kultur
- Interview
Angela Summereder: »Es ist immer ein Dialog«
Die österreichische Regisseurin Angela Summereder über Filmemachen als Prozess, Widersprüche des Dokumentarischen und Wege abseits der Kulturindustrie

Das Wiener Filmfestival Viennale hat Ihnen in diesem Jahr eine Personale gewidmet. Mit »Zechmeister« wurde ihre Arbeit 1981 einem größeren Publikum bekannt. Wie blicken Sie auf Ihr Debüt zurück?
Der Stoff ist mir bis heute sehr nahe – allein deshalb, weil die Geschichte von Maria Zechmeister sich am Ort ereignet hat, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist ein kleiner Ort in Oberösterreich, etwa 1000 Einwohner. Ich habe schon als Kind gespürt, dass ein Schweigen über dem Thema liegt: Wenn der Name Zechmeister fiel, wurde es still. Da war etwas, worüber alle Bescheid wussten, aber niemand sprechen wollte. Auf Hinweise meiner Mutter hin habe ich begonnen zu recherchieren und gemerkt, welches Ausmaß das Verdrängte angenommen hatte – von Männerjustiz, Konflikten zwischen kriegstraumatisierten Heimkehrern und den Frauen, die während des Krieges allein zurechtkommen mussten. Im Fall Zechmeister verhandelte das Gericht kein individuelles Schicksal, es war ein chauvinistisch und sexistisch geprägtes Urteil über Frauen, die in der Zeit der Abwesenheit der Männer begonnen hatten, sich etwas freier zu bewegen.
1949 wurde Maria Zechmeister wegen angeblicher Vergiftung ihres Mannes zu lebenslanger Haft verurteilt. Am Stammtisch galt sie schon zuvor als schuldig. In Ihrem Film treten Protagonistinnen auf, die dem Gerede etwas entgegensetzen.
Alles, was im Film gesprochen wird, basiert auf Quellen, auf Vernehmungsprotokollen, auf Gerichtsakten. Die kleinen Dialoge zwischen dem ermittelnden Beamten und seiner Frau sind als einzige frei erfunden – eine Notiz der Autorin, könnte man sagen. Die Stimme dieser Frau spiegelt meine eigene Position wider. Neben der Ärztin, die Alois Zechmeister untersucht hat, stellt sie in Frage, ob das, was gesagt wird, überhaupt stimmt.
»Zechmeister« bewegt sich zwischen dokumentarischer Genauigkeit und fiktionalen Elementen. Warum dieses Oszillieren?
In »Zechmeister« wollte ich keine klassische Trennung zwischen Dokumentation und Fiktion. Ich war damals noch unerfahren und wusste vor allem, was ich nicht wollte: keinen Spielfilm und auch keinen rein dokumentarischen Zugang. Mir ging es um eine übergeordnete Ebene, die über den Einzelfall hinausweist. Deshalb habe ich reale Orte mit symbolischen Räumen verbunden: das Haus der Zechmeister, die Praxis der Ärztin – sie spielt sich selbst und ist eine weitere Gegenstimme – sowie surreal und archaisch anmutende Orte wie der Baum, eine Linde, unter dem Gericht gehalten wird.
Angela Summereder wurde 1958 in Oberösterreich geboren. Sie studierte Filmregie, Germanistik und Publizistik in Salzburg und Wien. Summereder arbeitet als Autorin und Regisseurin, ist in der Kunstvermittlung und in der Erwachsenenbildung tätig. Ihr Spielfilmdebüt »Zechmeister« wurde beim Berlinale Forum gezeigt. Mit »Vermischte Nachrichten« (2006), »Jobcenter« (2009) und »Aus dem Nichts« (2015) arbeitete sie an einer regional situierten Trilogie. Ihr Essayfilm »B wie Bartleby« hatte Premiere in Lissabon beim Festival Doc Lisboa, dann beim Wiener Filmfestival Viennale. Sie lebt in Wien.
Ihre späteren Filme sind weniger experimentell und stärker dokumentarisch. Wie kam es dazu?
Zwischen »Zechmeister« und meinem zweiten Film gibt es eine längere Pause – und ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe andere Sachen gemacht, die meinen Blick geöffnet haben für andere Lebenswirklichkeiten. Das zeigt sich in den Folgefilmen. »Vermischte Nachrichten« von 2006 war, anders als »Zechmeister«, nicht als größere Produktion angelegt. Darin gehen zwei Menschen ohne Geld auf die Straße und sammeln Geschichten, ein bisschen im Stil des Cinéma vérité. Das konnte gelingen, weil ich mit meinem Filmkollegen Michael Pilz unterwegs war, der viel Erfahrung hat, mit dieser Art zu drehen, und gute Kamera-Arbeit gemacht hat.
Kapitalistisch getriebene Filmproduktionen sind zu Ende, wenn das Geld aus ist. Sie sagen, dass sie Filme machen, wenn Zeit dazu ist. Warum?
Ich habe zwei Kinder und war als Alleinerzieherin immer auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten, die sich mit meiner Lebenssituation vereinbaren ließen. Ich wollte etwas tun, das Sinn ergibt – und das sind nicht unbedingt Jobs, die gut bezahlt sind. Mein jüngeres Kind hatte gesundheitliche Probleme, da ging es ums Überleben – Film war da kein Thema mehr. Ich hätte meinen Kindern sagen müssen: kein Ausflug am Wochenende, kein Spielen am Abend – ich muss nachdenken, ich bin deshalb grantig und kaum ansprechbar. Dazu kam die ständige Sorge: Wie zahlen wir die nächste Miete? Wann ist das alles zu Ende? So ein Leben wollte ich meinen Kindern – und mir selbst – nicht zumuten. Also habe ich gesagt: Die Filmwelt ist jetzt erst einmal vorbei.
Filmschaffende thematisieren prekäre Lebenssituationen und Klassenlagen eher selten. Muss sich ein Sprechen darüber erst etablieren?
Ich glaube, diese Vorstellung von einer einheitlichen Karriere ist ein Männerding. Ich finde Biografien interessanter, wenn Menschen sich in unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten bewegt und bewährt haben. Und ich empfinde es als große Bereicherung, weil da ganz andere Einblicke zustande kommen.
»Jobcenter« von 2009 ist der zweite Teil ihrer filmischen Trilogie aus dem oberösterreichischen Innviertel. Wie ist dieser Film entstanden?
In »Jobcenter« schwingt viel von meiner eigenen Existenzangst mit – von Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, und von den Geschichten der Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Ich war selbst eine Zeit lang als Trainerin in dieser Einrichtung tätig, und einiges, was ich dort erlebt habe, ist in den Film eingeflossen. Ursprünglich wollte ich eine nüchterne Institutionsbeobachtung machen, im Stil des direct cinema. Aber schnell wurde klar, dass es um mehr geht: um die Frage, was Arbeit überhaupt ist – und was es bedeutet, in einer wirtschaftlich »prosperierenden« Gegend keine sogenannte Arbeit zu haben. »Jobcenter« versucht, diese Widersprüche sichtbar zu machen: die sozialen Bewertungen, die Mechanismen der Ausgrenzung sowie die Unsicherheit und Scham, die viele Menschen in solchen Situationen begleiten.
Sie interessieren sich nicht bloß für die Vermittlung, sondern das Leben ihrer Protagonist*innen. Was machte die Zusammenarbeit mit ihnen besonders?
Ich konnte mich auf die Protagonist*innen einlassen, weil ich mit ihnen länger, über die Zeit der Dreharbeiten hinaus, gearbeitet habe. Dadurch entstand ein Vertrauensverhältnis, das für die Dreharbeiten entscheidend war. Die Gespräche liefen vor und nach dem Dreh weiter, alles war eingebettet in einen längeren gemeinsamen Prozess. Die Beteiligten hatten Mitspracherecht. Ich habe sie gefragt, was ihnen außerhalb des Jobcenters wichtig ist, was ihnen Freude macht. Mich interessierte, was ihnen Kraft gibt. Und die Frage: Was gibt es eigentlich jenseits von (Erwerbs-)Arbeit?
Wenn man an derzeitige Arbeitsmarktmaßnahmen denkt, war der Umgang mit Menschen in »Jobcenter« offenbar ein anderer, menschlicherer.
Das war in Ried im Innkreis in Oberösterreich – und schon damals eine besondere Situation. Der Träger der Einrichtung war aus dem Betriebsrat einer Firma hervorgegangen, die viele Mitarbeiter*innen gekündigt hatte, und erhob von daher den Anspruch, mit den Betroffenen anders umzugehen, offener zu kommunizieren. Ob das tatsächlich so geblieben ist, kann ich nicht sagen.
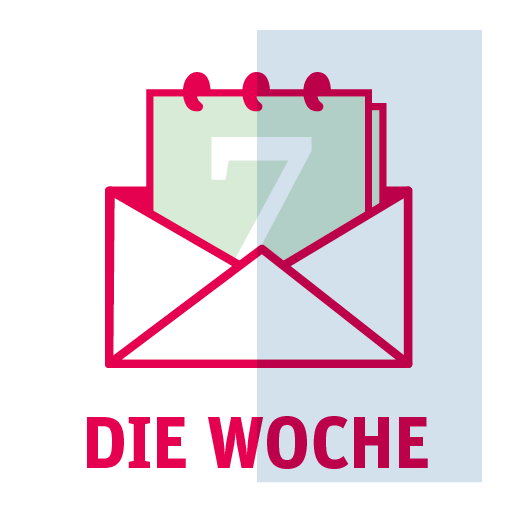
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Viele Regisseur*innen haben mit Drehbeginn eine fixe Kadrage im Kopf. Für Sie heißt filmen, einen Raum aufzumachen, um sich überraschen zu lassen. Was bedeutet das für Ihre Arbeitsweise?
Diese Offenheit setzt voraus, dass man langfristiger arbeiten kann. Man kann nicht einfach mit dem Dreh beginnen und erwarten, dass sich alles fügt. Für meine Filme gibt es immer eine lange Vorbereitungszeit, in der wir gemeinsam das Thema und die Drehsituationen ausloten. Ich beobachte, wer diese Menschen sind, was sie mitbringen – und versuche, dem filmisch gerecht zu werden. Es ist immer ein Dialog: Ich arbeite daran, jede Person so zu zeigen, dass dies dem entspricht, wie sie ist.
»B wie Bartleby« feierte bei der diesjährigen Viennale Österreich-Premiere – ein Essayfilm, der die Schichten des Satzes »I would prefer not to« freilegt. Woher kommt die Vielstimmigkeit?
Die Idee entstand aus einer Debatte zwischen Benedikt Zulauf und mir: Kann man überhaupt einen Bartleby-Film machen, der dem Text gerecht wird? Wie müsste der aussehen? Eine der größten Herausforderungen war, Herman Melvilles Kurzgeschichte so zu vermitteln, dass sie auch ohne Vorwissen verständlich bleibt. Zugleich wollten wir zeigen, wie der Text in unterschiedlichen sozialen Wirklichkeiten ankommt – was Menschen daraus machen, ob sie ihn mit ihrem Leben verbinden können. Keine dieser Lesarten ist richtig oder falsch. Der Film selbst ist die Antwort: ein Raum, in dem viele Deutungen nebeneinander bestehen bleiben – die von Rappern in einem Wiener Jugendzentrum ebenso wie die von Kids mit und ohne Migrationshintergrund oder die von wohnungslosen Männern, die im Sozialprojekt »Vinzi Rast« leben.
Was bedeutet »I would prefer not to« für Sie?
Ich arbeite bewusst ohne große Namen und aufwendige Drehs, mit Konzepten, die offen bleiben und sich entwickeln dürfen. Das macht die Förderung oft schwierig, weil dort alles schon im Voraus festgelegt sein soll. Eine Kollegin meinte einmal: »Du brauchst große Namen, Stars und große Firmen, um auf große Festivals zu kommen.« Mein Impuls dazu lautet: »I would prefer not to.« Da halte ich es lieber mit dem finnischen Regisseur Aki Kaurismäki, der für seine Filme folgende Widmung formuliert: »to all admirers of modest cinema«.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.