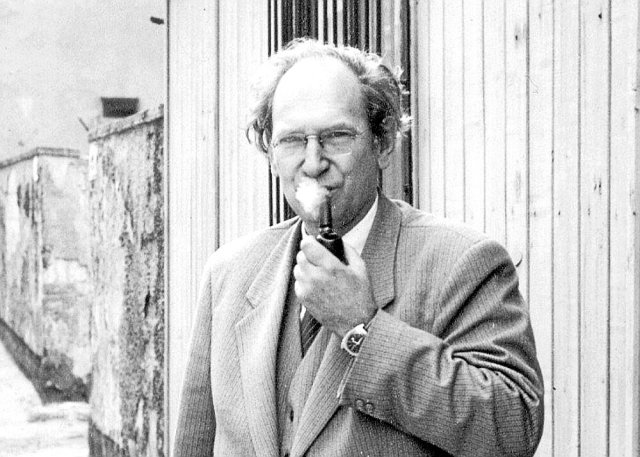- Kultur
- Postkolonialismus
Eine verpasste Gelegenheit
Gedanken zu einer abgesagten Ausstellung über deutschen Postkolonialismus

Wieder ist eine Ausstellung abgesagt, wieder gibt es Auseinandersetzungen um die postkoloniale Theorie – oder sind es die postkolonialen Studien oder die »postkoloniale Bewegung« oder einfach »der Postkolonialismus«? Dieses Mal geht es um die von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) im Rahmen der Reihe »Sequenzen: Verflochtene Internationalismen« organisierte Ausstellung »Das Jahr 1983«, die eigentlich koloniale und postkoloniale Verflechtungen Deutschlands – vor allem der DDR – mit Namibia thematisieren sollte.
Auslöser des Konflikts scheinen Posts der Kuratorin Zoé Samudzi in sozialen Netzwerken gewesen zu sein; allerdings bestanden offensichtlich auch fundamentale Differenzen über das Konzept und einige Inhalte der Ausstellung.
Dass eine Ausstellung, in der die gewalttätige, genozidale Vergangenheit des deutschen Kolonialismus thematisiert wird, Kontroversen verursacht, ist nicht überraschend. Der Umgang damit und die Diskussion darüber werden aber aktuell unvermeidlich in den Kontext der großen Diskussion um »den Postkolonialismus« gestellt. Diese hat sich seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres verschärft, besteht aber eigentlich schon lange. Besonders intensiv wird sie – immer wieder befeuert durch neue Publikationen und über verzweigte Debatten – seit einer Absage an den kamerunischen Historiker und Philosophen Achille Mbembe geführt, der die Ruhrtriennale 2020 eröffnen sollte.
Bei den Debatten stehen Äußerungen zu Israel und Palästina im Vordergrund, dabei geraten aber oft Intellektuelle, Künstler*innen und Projekte unter die Räder, die sich eigentlich primär mit der Gewaltgeschichte des deutschen Rassismus und Kolonialismus beschäftigen. So auch bei der Ausstellung »Das Jahr 1983«, die koloniale Gewalt und postkoloniale Solidaritätsarbeit auf komplexe Weise miteinander verflechten und dabei gerade die schwierigen Ambivalenzen und Kontinuitäten des deutschen Verhältnisses zu Namibia ausloten wollte.
Kernstücke der Ausstellung sollten zwei Installationen der namibischen Künstlerin Tuli Mekondjo und des Architektur- und Kunstkollektivs Forensic Architecture/Forensis sein. Mekondjo wollte in ihrer Installation zwei deutsche Uniformen gegenüberstellen – die imperiale Uniform der einstigen kolonialen »Schutztruppe« und eine DDR-Uniform, wie sie auch von Guerillakämpfer*innen der südwestafrikanischen Befreiungsorganisation SWAPO getragen wurde. Beide wurden bestickt mit historischen Motiven, die sich, so ist dem Statement der Kuratorin Zoé Samudzi und dem Ankündigungstext der Ausstellung zu entnehmen, mit Mutterschaft, indigenen Traditionen und Militarisierung auseinandersetzen sollten. Ich kann nur vermuten, dass damit eine komplexe Auseinandersetzung mit lokalen Erinnerungspraxen und der Erfahrung von Genozid, Apartheid und Widerstand möglich gewesen wäre, die der Diskussion um die deutsche Kolonialvergangenheit und heutige Verantwortung durchaus zuträglich wäre.
Ebenso sollte die Ausstellung den Bericht von Forensic Architecture mit Fotos eines deutschen Offiziers kontrastieren, der während seiner Beteiligung am Genozid Aufnahmen von deutschen Militärs in ihrer Freizeit und bei Ruhepausen machte.
Forensis und Forensic Architecture unternahmen eine Rekonstruktion des berüchtigtsten Konzentrationslagers während des Genozids an den Herero und Nama: die Haifischinsel (heute Shark Island), eine felsige Insel vor der Küste Namibias. Die beiden Gruppen erhoben geologische und archäologische Daten, die einen detaillierten Überblick über Struktur und Funktionsweise des heute von touristischer Infrastruktur überbauten Lagers geben. Die allergrößte Mehrheit der Zwangsarbeit, Folter inklusive Vergewaltigung und medizinischen Experimenten des Eugenikers Eugen Fischer unterworfenen Insassen starb schnell an Krankheiten und Hunger. Heute sind die Massengräber unter touristischen Anlagen verschwunden, und es gibt keine lokale Erinnerung an das Lager. Der Bericht ist online auf der Website von Forensic Architecture einsehbar. Empirisch gesättigt und mit genauer Methodik wird darin ein verantwortungsvoller Umgang mit der Erinnerung an den Genozid angemahnt – in Namibia wie in Deutschland.
Wenn wir über solche Ausstellungen diskutieren, wenn wir über postkoloniale Studien streiten, wird oft vergessen, worum es dabei eigentlich geht: den Raum der Diskussion und der Erzählungen – auch über uns selbst – zu öffnen für die Perspektiven der »anderen«, derjenigen, die in den diesen Erzählungen zugrunde liegenden historischen Ereignissen und Prozessen oft eine wichtige Rolle spielten, aber über die sich die Erzählungen ausschweigen.
So drehte sich der Konflikt zwischen Samudzi und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden unter anderem um ihre Äußerung: »Germany only partially recognized the Nama and Ovaherero genocide.« (Deutschland erkennt den Völkermord nur teilweise an) Die SKD widersprachen, Deutschland habe 2021 offiziell den Genozid als solchen anerkannt. Samudzi aber bezog sich auf die Kritik der Opfergruppen, also von offiziellen Vertreter*innen der Herero und Nama, eine Anerkennung des Genozids müsse ihnen gegenüber stattfinden und sei nicht mit einer Zahlung von Entwicklungshilfe an die namibische Regierung statt echter Reparationen an die Nachfahren der Opfer abgegolten. Zudem hieß es in der gemeinsamen Erklärung, die die deutsche und namibische Regierung unterschrieben, distanzierend, dass man die »Gräueltaten« der deutschen Kolonialzeit »aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnen würde«.
Der eigentliche Skandal besteht darin, wie unbekannt diese Kritik, aber auch ganz generell die Erinnerung an den Genozid, dessen Opfer und ihre Überlebensgeschichte in Namibia nach der deutschen Kolonialzeit in Deutschland ist, wie unbekannt auch die postkolonialen Verflechtungen West- wie Ostdeutschlands mit dem Südlichen Afrika: Während die BRD (Franz Joseph Strauß enthusiastisch vorneweg) beste Geschäftsbeziehungen zur Apartheidregierung pflegte, engagierte sich die DDR in der Solidaritätsarbeit nicht immer uneigennützig (so verbesserte sich in den Handelsbeziehungen mit Mosambik zunächst die eigene Devisenbilanz) und reflektierte den Rassismus der eigenen Gesellschaft nicht (was vor allem die Vertragsarbeiter*innen aus Vietnam und Mosambik zu spüren bekamen).
Man kann viel und mit guten Gründen über die postkolonialen Studien diskutieren und vieles an den vielen verschiedenen Ansätzen kritisieren, die unter dieses Label fallen. Man muss aber auch einmal darüber reden, was die eigentliche Forderung dahinter ist: sich mit den Geschichten der »anderen« zu konfrontieren und auszuloten, welche Bedeutung sie für die eigene Geschichte haben.
Die Ausstellung »Das Jahr 1983« ist so eine verpasste Gelegenheit, einige wenig bekannte Aspekte dieser gemeinsamen, »verflochtenen«, Geschichte zu erkunden. Ein Antisemitismus-Generalverdacht gegen »den Postkolonialismus«, wie ihn aktuell linke wie rechte Politiker*innen, Aktivist*innen und Intellektuelle formulieren, hilft vor allem jenen, die die dringend notwendige Aufarbeitung der kolonialen Geschichte Deutschlands wie auch die Auseinandersetzung mit Rassismus, Migration und den Ausbeutungsstrukturen eines global agierenden Kapitalismus blockieren wollen.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.