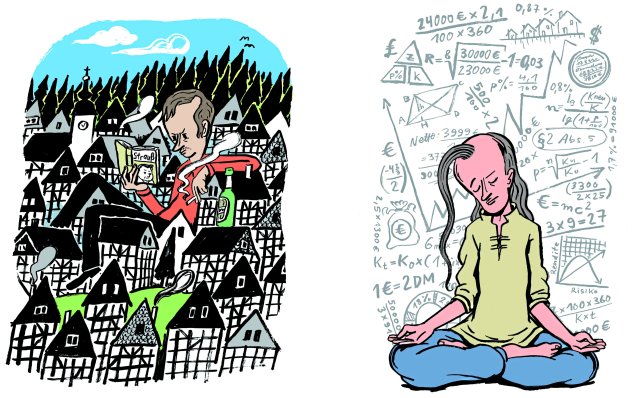- Kultur
- Postkolonialismus
»Schule des Südens«: Kriegsschauplatz und Sehnsuchtsort
Onur Erdurs Kollektivbiografie französischer Theorie begleitet Bourdieu, Foucault und Co. zu den kolonialen Ursprüngen ihres Denkens

Theoriegeschichte ist ein politisches Kampffeld. Unschwer ist das zu erkennen an den öffentlichen Abrechnungen, die sich seit einiger Zeit gegen die französische Theorie richten. »French Theory«, Dekonstruktion, Poststrukturalismus, Postfundamentalismus oder schlicht Postmoderne, so ist man sich einig, habe uns eigentlich alle Probleme eingebrockt. Der postmoderne Relativismus im Denken von Derrida und Co. mündete direkt ins postfaktische Zeitalter der Desinformation und der identitätspolitische Kulturkampf, bei dem die Rechte nun global abräume und die Linke in der Bedeutungslosigkeit verschwinde, sei das direkte Erbe des Poststrukturalismus. Freilich ist das eine Projektion – die im Übrigen genau jenem Kulturkampf entspricht, der sich jedes Wahrheitsgehalts entledigt hat –, aber: eine politisch nützliche. Denn wie andere Desinformationen auch entfaltet sie ihre Wirkung schon dadurch, dass sie als Assoziationskette verfängt. Nur unendlich mühsam lässt sich der Irrglauben rückbauen und selbst dann hat Aufklärung nur vergleichbar geringen Effekt.
Eine solche Mühe hat sich der Berliner Kulturwissenschaftler Onur Erdur gemacht, auch wenn diese Rolle des Aufklärers gegen das Postmoderne-Bashing eher nachträglich konstruiert wurde. Denn eigentlich folgt seine Essaysammlung »Die Schule des Südens« einer anderen Intention. Er spürt den kolonialen Erfahrungen der zentralen Philosophen (und einer Philosophin) jener französischen Theorie der 60er und 70er Jahre nach.
Erfahrung des Widerspruchs
In Algerien, Marokko und Tunesien sucht er die »kolonialen Wurzeln der französischen Theorie« auf, damit jenes Denken nicht »in einen kontextlosen, ahistorischen und unschuldigen Raum verlegt wird«. Denn genau solche Abstraktion ermöglicht die politische Kampfdeutung, gegen die er »einige Richtigstellungen historischer Art vorzunehmen« versucht, um »die Kartierung des intellektuellen Feldes eben nicht jenen zu überlassen, die mit den Theorie-Tribunalen ausschließlich ihre politische Agenda verfolgen«.
Erdurs Essays sind dabei vor allem bestechend schön. Wach und klar folgt er den Protagonisten in die politischen Zerwürfnisse, Dilemmata und erschütterten Überzeugungen, die ihren Theorien auch zugrunde lagen. Kurzum, er folgt ihnen in den Süden und in die ehemaligen französischen Kolonien, die sowohl zum Kriegsschauplatz wie zum romantischen Sehnsuchtsort wurden. Im Algerienkrieg zwischen 1954 und 1962 zeigten sich die bis zum Bürgerkrieg verdichteten Widersprüche zwischen universalistischer Republik und entwürdigendem bis grausamem Imperialismus. Und aus Erdurs Texten wird deutlich, wie händeringend die Protagonist*innen jener Theoriebewegung damals nach einem Ausweg aus diesen Widersprüchen suchten. Sie wollten über den unerträglich zugespitzten Widerspruch, das moralische Dilemma und die theoretische Sackgasse radikal hinaus.
Dies ist der gemeinsame Nenner jener Theorieinnovationen, die natürlich vielstimmig und heterogen waren. Aber jene French Theory gründete auf diesen gemeinsamen Erfahrungen, so Erdurs Intuition. Da ist etwa der berühmte Pierre Bourdieu, der 1955 zum Militärdienst nach Algerien einberufen wird und mitten in den Widerspruch gerät, als antimilitaristischer Philosoph im Kolonialkrieg wirken zu müssen. Das schlechte Gewissen schürte das Bedürfnis, sich einerseits zu entziehen, also in eine möglichst zivile Tätigkeit zu gelangen, und sich andererseits für die algerische Sache nützlich zu machen. Bourdieu wurde zum Soziologen der algerischen Gesellschaft und versuchte, ihr zu ihrem Recht zu verhelfen. Auch nach dem Krieg blieb er dort und forschte, angetrieben einerseits von »Identifikations-, Schuld- und Moralfragen«, andererseits als Profiteur jener »Verstrickung in koloniale Zusammenhänge«, die ihm seine extensive Forschung erlaubte.
Mit »dem heimlichen und ständigen Gefühl der Schuld« betrieb Bourdieu seine Feldstudien in Algerien.
-
Mit »dem heimlichen und ständigen Gefühl der Schuld und der Auflehnung angesichts so vielen Leidens und so großer Ungerechtigkeit«, wie Erdur Bourdieu zitiert, betrieb er seine Feldstudien vor Ort und entwarf jenes Konzept, das ihn später zum Soziologen von Weltrang werden ließ. Sein Habitus-Begriff war der Versuch, die Entfremdung und Deprivation der »entbäuerlichten Bauern« der algerischen Gesellschaft als »einverleibte, also inkorporierte Struktur« zu fassen. Nachdem Bourdieu wieder in Frankreich angekommen war, kehrte er ausgerechnet in seine Heimatregion des Béarn zurück und erforschte dort autosoziobiografisch den ländlichen Raum Frankreichs. Was bei Autoren wie Didier Eribon in Deutschland vor zehn Jahren als großer Theoriewurf gefeiert wurde, löste auch deswegen in Frankreich keine großen Reaktionen aus, weil bereits Bourdieu diese soziologische Erkundung einer Gesellschaft im Umbruch – an der eigenen Biografie – vorgenommen hatte. Die Möglichkeitsbedingung dessen, so Erdur, lag in der Selbstentfremdung durch die koloniale Erfahrung.
Schuld und Dank
Nach Erdur lässt sich dieser Effekt Bourdieus verallgemeinern: Die Philosoph*innen »wurden sich selbst dabei fremd, ihrer Sprache und ihrer Nation, und haben dadurch ihre Philosophie und ihren Stil gefunden«. Selbstreflexion durch Entfremdung – für die meisten der Intellektuellen geschah dies durch die Zäsur des Algerienkriegs. Sie verbanden daher mit diesen Erfahrungen zugleich ein »Gefühl von Schuld (französisch dette)«, das immer auch »begleitet von einer Art Dank (ebenfalls dette)« war. Diese Prägung wurde in den jeweiligen Biografien unterschiedlich verhandelt. Jean-François Lyotard schmuggelte nach seiner Rückkehr aus dem Krieg Waffen und Geld für die algerische Unabhängigkeitsbewegung, während er zugleich im Regierungsauftrag forschte. Roland Barthes entzog sich der politischen Positionierung zum Algerienkrieg, hatte aber in Marokko ein Erweckungserlebnis, das ihn zum Ideologiekritiker werden ließ. Michel Foucault sympathisierte gar mit Charles de Gaulles Algerienpolitik, während er in Tunesien das »Bild eines sonnenhungrigen Glückssuchers« abgab.
Étienne Balibar ging in Paris als Student gegen den Algerienkrieg auf die Straße und erlebte die Gewalt des Krieges vermittelt über Bombenanschläge der algerischen Terrororganisationen oder Gewalt der Polizei. In der Nacht auf den 17. Oktober 1961 massakrierte die Polizei 200 algerische Demonstranten und warf viele der toten Algerier nachts in die Seine. Bis in die 90er Jahre überdeckt ein Schweigen diesen Ausdruck des staatlichen Rassismus, den Frankreich wie ein Trauma aktiv verdrängte. Erst 2011 erkannte die französische Regierung das Verbrechen an. Für Balibar war es der Anstoß einer lebenslangen theoretischen Rassismuskritik, für Jacques Rancière hingegen Ausgangspunkt eines Denkens der Desidentifikation. Wie dieser selbst schrieb: »Was meine Generation angeht, so beruht die Politik auf der unmöglichen Identifizierung mit den im Oktober 1961 von der französischen Polizei im Namen des französischen Volkes zu Tode geprügelten und in die Seine geworfenen Algeriern.«
Abstrakte Negation
Die Essays und Intellektuellenporträts zeigen, wie sich die widersprüchliche Situation jener Zeit in Ambivalenzen der Gedankengebäude übersetzt – und allein dies widerspricht allzu einheitlichen Deutungen der französischen Theorie. So tritt Rancière plötzlich als Gegenspieler der Identitätspolitik in den 90er Jahren auf, der für einen Universalismus des Politischen einsteht und damit dem konservativen Republikanismus näher ist. Foucault suchte theoretisch nach »Heterotopien«, Gegenorten der Emanzipation, und fand diese ausgerechnet in den touristischen Ferienanlagen des Club Méditerranée. Während sein widerständiges Denken zum expliziten Bezugspunkt postkolonialer Theorie wurde, kanzelte ihn eben diese aufgrund »seiner bedingungslosen proisraelischen Haltung« während des Sechstagekriegs 1967 ab. Jacques Derrida und Hélène Cixous rangen mit der Kritik am französischen Kolonialismus, »wussten aber auch, dass eine algerische Unabhängigkeit für ihre jüdischen Familien den Verlust der Heimat bedeuten könnte«.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Auch wenn Erdur dem Denken einen konkreten Raum zuweisen will, seine Schilderungen der intellektuellen Suchbewegungen zeigen eher, wie losgelöst und freischwebend sich diese vollzogen. Den Theoretiker*innen drängte sich eine politische Realität schärfster Widersprüche auf, aber im Denken schienen sie frei zu sein, sich die Bedingungen des Denkens selbst neu zu erschaffen. Was Erdur zwar beschreibt, aber nicht erkennt: Dass dieses freischwebende Denken selbst eine gesellschaftliche Grundlage hat, die es theoretisch zu reflektieren gälte. Insofern hätte den französischen Freigeistern durchaus etwas materialistische Aufklärung gut getan – auch wenn man es keinem von ihnen verübeln kann, sich in den 60er Jahren vom betonharten Parteimarxismus abgewandt zu haben. Ihr Leiden an den Widersprüchen war nicht nur intellektuelle Praxis, sondern ganz reale Wirklichkeit, der man sich eben nicht der Idee nach entziehen kann.
So wird schlussendlich deutlich: Die geteilte Theoriegrundlage der French Theory bleibt die abstrakte Negation, ihr Denken damit notwendig abstrakt – und diese Abstraktion ermöglichte es erst, die Theorien so zu drehen und zu wenden, bis daraus schließlich jene Pappkameraden des heutigen Kulturkampfs wurden. So richtig es ist, dass Erdur diesen Deutungen widerspricht, so wichtig wäre es zu zeigen, was diese Abstraktheit des französischen Denkens trotzdem mit der heutigen Regression zu tun hat.
Onur Erdur: Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie. Matthes & Seitz 2024, 335 S., geb., 28 €.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.