- Kommentare
- Sexismus
Gleichstellung: Privilegien werden nie von allein geteilt
Rechte machen gegen Quotenregelungen zur Gleichstellung mobil

Am 6. Mai veröffentlichte der französische Verband der Diversity-Manager sein Barometer zu Sexismus und Diskriminierung in Unternehmen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, wie viele andere Berichte auch, dass unsere Fortschritte bei der Gleichberechtigung stagnieren. Aufschlussreich dabei: Hinsichtlich der Quotenregelungen, mit deren Hilfe ganz konkret Macht und Privilegien umverteilt werden können, zeigt sich ein deutlicher Bruch – Frauen unterstützen sie, während Männer, insbesondere die »Höhergestellten«, sie ablehnen. Die Botschaft dahinter ist klar: Die derzeitigen Inhaber von Privilegien weigern sich kategorisch, diese abzugeben oder zu teilen.
Rufen wir uns die Quotenregelung ins Gedächtnis. Ein Gesetz bereits aus dem Jahr 2011 sah eine Frauenquote von 40 Prozent in Vorständen vor; ein Gesetz von 2021 verlangt in Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten, ein Drittel der Leitungspositionen mit Frauen zu besetzen, bis 2030 sollen es in einem weiteren Schritt 40 Prozent sein. Es gibt übrigens keinen Grund dafür, warum mit der Schwelle von 1000 Mitarbeiter*innen die Mehrzahl der Unternehmen von dieser Regelung ausgenommen ist.
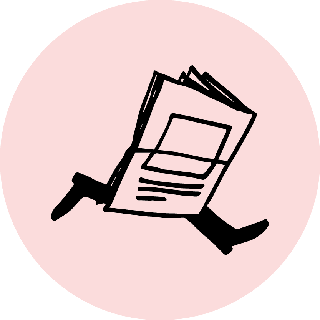
Die linke Medienlandschaft in Europa ist nicht groß, aber es gibt sie: ob nun die französische »L’Humanité« oder die schweizerische »Wochenzeitung« (WOZ), ob »Il Manifesto« aus Italien, die luxemburgische »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek«, die finnische »Kansan Uutiset« oder »Naše Pravda« aus Prag. Sie alle beleuchten internationale und nationale Entwicklungen aus einer progressiven Sicht. Mit einer Reihe dieser Medien arbeitet »nd« bereits seit Längerem zusammen – inhaltlich zum Beispiel bei unserem internationalen Jahresrückblick oder der Übernahme von Reportagen und Interviews, technisch bei der Entwicklung unserer Digital-App.
Mit der Kolumne »Die Internationale« gehen wir einen Schritt weiter in dieser Kooperation und veröffentlichen immer freitags in unserer App nd.Digital einen Kommentar aus unseren Partnermedien, der aktuelle Themen unter die Lupe nimmt. Das können Ereignisse aus den jeweiligen Ländern sein wie auch Fragen der »großen Weltpolitik«. Alle Texte unter dasnd.de/international.
Die Europäische Union arbeitet ebenfalls an Quotenregelungen. Ein Beispiel ist die vom Europäischen Parlament am 22. November 2022 verabschiedete Richtlinie über Frauen in Führungspositionen. Die Existenz solcher europäischen Regeln ist auch ein Bollwerk zum Schutz unserer nationalen Mechanismen in dieser Hinsicht. Mit anderen Worten, Frankreich kann nicht zurückweichen. Es sei denn, wir würden von unseren europäischen Verpflichtungen abweichen … Es überrascht dabei nicht, dass das (rechtsextreme – d. R.) Rassemblement National in seinem Programm 2024 vorgeschlagen hatte, die Möglichkeit einer »Ausnahme von den europäischen Regeln« einzuführen.
Der Widerstand gegen Quotenregelungen ist Teil einer breiteren reaktionären Ideologie, die stetig an Boden gewinnt. Erinnern wir uns an das, was Éric Zemmour (rechtsextremer Politiker – d. R.) sagte: »Wenn eine Frau an der Macht ist, haben die Leute Probleme.« Denn in der reaktionären Ideologie müssen Frauen »ermutigt« werden, in die Küche zurückzukehren. Aus diesem Grund wurde die berufliche Gleichstellung in den Programmen von Rassemblement oder Reconquest (Zemmours Partei – d. R.) nicht erwähnt.
Die französische Tageszeitung L’Humanité wurde 1904 vom Sozialisten Jean Jaurès gegründet. Ursprünglich als Sprachrohr für die sozialistische Bewegung gedacht, vertritt sie seitdem konsequent linke und sozialistische Positionen. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit, Arbeitnehmer*innenrechte und weltweiter Frieden ein.
Die Zeitung ist das ehemalige Zentralorgan der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF). 1999 entfiel der explizite Hinweis auf die Partei. Seit 2004 gehört die Zeitung zu 40 Prozent der PCF, Freund*innen und Mitarbeiter*innen halten je zehn Prozent, die Gesellschaft der Freunde 20 Prozent und Großunternehmen wie Sparkassen, der Sender TF1 und der Rüstungskonzern Lagardère den Rest. Heute arbeiten bei der L’Humanité etwa 60 Redakteur*innen; die Zeitung hat etwa 40 000 Abonnent*innen. Das 1930 erstmals begangene Pressefest, die Fête de L’Humanité, ist bis heute ein wichtiger Termin des gesellschaftlichen Lebens in Frankreich.
Aber, wie Gisel Halimi (französische Feministin – d. R.) zu Recht fragte: »Kann eine Frau ein Teil von Projekten und Freiheit werden, wenn sie der (wirtschaftlichen) Macht der Männer unterworfen bleibt?« Die Umfrage der Diversity-Manager erinnert uns an eine grundlegende Wahrheit: Ohne rechtliche Zwänge verteilen sich Privilegien nie von selbst.
Dieser Text ist am 7. Mai in unserem Partnermedium L’Humanité erschienen. Der mit KI-Programmen übersetzte Beitrag wurde nachbearbeitet und gekürzt.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







