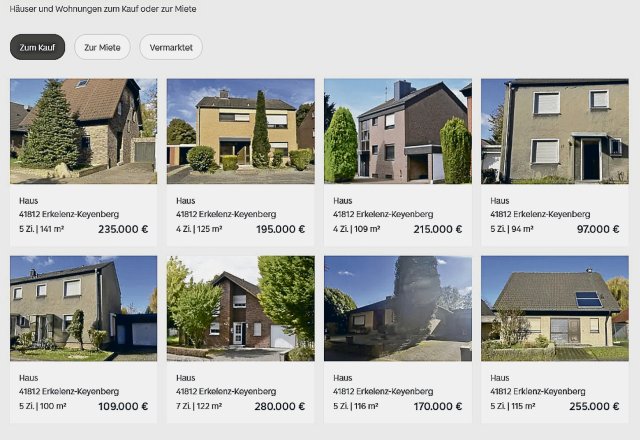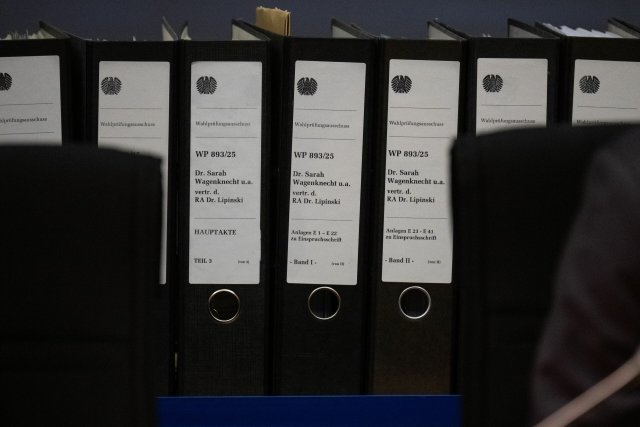- Politik
- Indigene in Kolumbien
Wo Gemeinschaft schützt
Ordnung ohne Waffen: Indigene in Kolumbien und ihr Leben im Ausnahmezustand

In den frühen Morgenstunden liegt ein feiner Nebel über Rioblanco, einem kleinen Bergdorf am Fuße des Vulkans Sotará im Südwesten Kolumbiens. Hier, in den Anden auf 2900 Metern, weht es scharf und kalt; die indigenen Dorfbewohner tragen selbst gewebte graue Ponchos aus Schafwolle und gestrickte Mützen mit Ohrenklappen, die Männer oft gefilzte schwarze Zylinder.
Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen und Mais wachsen auf kleinen Feldern am Rand des Dorfes. In den Küchen dampft die Mote-Suppe – ein Eintopf aus geschältem Mais, Kartoffeln und Kuhkopf. In der Gemeinschaft der Yanacona begrüßen und unterhalten sich die Menschen auf Spanisch – ihre eigene Sprache wurde während der spanischen Kolonialherrschaft weitgehend ausgelöscht. In benachbarten indigenen Gemeinden wie denen der Nasa sprechen vor allem die Älteren noch Nasa Yuwe. Die Jüngeren verstehen es oft nur noch teilweise.
An manchen Sonntagen füllt sich die überdachte Markthalle mit Stimmen, Farben und Gerüchen. Dann ist Trueque – Tauschmarkt. Familien aus den umliegenden Gemeinden kommen zusammen, um ihre Produkte zu tauschen: alles ohne Geld. Roter, blauer und weißer Mais, wie man ihn außerhalb der indigenen Territorien kaum noch findet, wird neben Brombeeren, Hühnern und handgesponnenen Wollprodukten angeboten. Viele kommen mit der Chiva, einem bunt bemalten, offenen Bus. Der Name stammt vom spanischen Wort für Ziege, weil sich das Gefährt ebenso wendig und entschlossen durch die steilen Bergstraßen schlängelt.
Guerillafreie Zone
Trotz der Präsenz von Graffitis mit der Aufschrift »Farc-EP« an manchen Wänden gilt dieses Territorium als guerillafreie Zone. »Hier ist es ruhig«, sagen die Bewohnerinnen. Anders als in anderen indigenen Territorien, in denen sich »Acampamentos«, also Lager verschiedener Guerillagruppen, befinden, dominiert in diesem Dorf der Austausch – nicht der bewaffnete Konflikt.
Die Wächter dieser Ruhe tragen einen Namen: Guardia Indígena. Unter dem Dach des Regionalrats der Nationalen Indigenen-Organisation (Cric) schützt sie elf indigene Territorien des Departamento Cauca – unbewaffnet, aber sichtbar, mit ihren blauen ärmellosen Westen, dem Bastón (Schlagstock) und einer Trillerpfeife. Ihr Auftrag ist klar: das Territorium verteidigen, die Gemeinschaft bewahren, den Frieden sichern und zwangsrekrutierte Kinder aus den Fängen der bewaffneten Gruppen zurückholen.
In Dörfern wie dem hoch gelegenen Silvia reicht ihre Aufgabe längst über indigene Grenzen hinaus. Durch jahrelange Präsenz und konsequentes Handeln haben sie sich das Vertrauen auch der nicht-indigenen Bevölkerung erarbeitet. Heute gelten sie als moralische Autorität, werden gerufen, wenn Spannungen entstehen und respektiert für ihre gewaltfreie Haltung.
Im Cauca operieren sieben bewaffnete Gruppen
Oveimar Tenorio ist politischer Koordinator der indigenen Wache im gesamten Departamento Cauca. »Seit dem Friedensabkommen mit der Farc im Jahr 2016 erleben wir in Kolumbien eine schwierige Zeit«, sagt er. »Der bewaffnete Konflikt wurde nicht beendet, sondern hat sich neu konfiguriert.« Der 30-Jährige ist ständig unterwegs. Von einem Territorium zum nächsten, von einer Gemeinde zur anderen. »Heute haben wir es mit einem Konflikt zu tun, der nicht nur politisch oder ideologisch motiviert, sondern vor allem ökonomisch und militärisch geprägt ist.«
Sieben bewaffnete Gruppen sind derzeit im Cauca aktiv. Mal tragen sie alte Namen wie Farc oder ELN, mal operieren sie anonym, hinter Drogenhandel, illegalem Bergbau und paramilitärischer Kontrolle. Viele der neuen Kämpfer kommen selbst aus indigenen Gemeinden. »Ein Großteil der neuen bewaffneten Gruppen rekrutiert sich aus unseren Gemeinden – etwa 60 Prozent ihrer Mitglieder sind Indigene«, sagt Tenorio. »Das bedeutet: Indigene töten Indigene.«
In den ländlichen Regionen ist der bewaffnete Konflikt längst Alltag. Selbst bei internationalen Treffen, wie dem ersten indigenen Forum für die Erde, im Juni in Popayán, ist die Gewalt spürbar. Um 18 Uhr, als das gemeinsame Abendessen beginnen sollte, krachte im Dorf ein Projektil auf den Boden – abgeschossen von einer Drohne. Die Gäste aus 20 Ländern bemerkten nichts, doch die Guardia wusste sofort Bescheid. Sie schwieg, um keine Panik auszulösen und kümmerte sich um die Absicherung des Gebiets.
Indigene Jugendliche: zwischen Konsum und Identität
»Diese bewaffneten Gruppen verursachen Chaos in den indigenen Territorien«, erklärt Tenorio, »durch Zwangsrekrutierung von Minderjährigen, durch die Vereinnahmung politischer Prozesse von Indigenen und Bauern, durch Angriffe auf unsere Autoritäten. Es ist ein gezielter Angriff auf das indigene Leben – verübt sowohl durch bewaffnete Gruppen als auch durch staatliche Politik, die Konzernen den Zugang zu unseren Territorien erleichtert.«
Die Zahlen sind eindeutig: Seit 2019 wurden 46 Mitglieder der Guardia Indígena ermordet. Auch Autoritäten, Wissenshüterinnen, Heiler und Älteste sind betroffen. Seit 2021 häufen sich die Angriffe auf Jugendliche. Die Angst geht um – nicht nur vor dem Feind von außen, sondern auch vor dem Zerfall von innen.
»Heute gibt es kein Gegenüber mehr, keine politische Agenda, keinen Dialog«, sagt Tenorio. »Früher konnten wir mit der Farc humanitäre Absprachen treffen. Heute sind die bewaffneten Gruppen in den Gemeinden selbst präsent – oft weiß niemand, wer zu wem gehört.«
»Die bewaffneten Gruppen verursachen Chaos in den indigenen Territorien: durch Zwangsrekrutierung von Minderjährigen, durch die Vereinnahmung politischer Prozesse von Indigenen und Bauern, durch Angriffe auf unsere Autoritäten.«
Oveimar Tenorio Koordinator der indigenen Wache im Departamento Cauca
In der Jugend spiegeln sich diese Spannungen. Auf der einen Seite: Engagement. Junge Menschen helfen in der Medienarbeit des Cric, der Regionalorganisation der Indigenen, sie filmen Versammlungen, schreiben Artikel, organisieren Bildungsprogramme. Andere vermarkten indigene Produkte auf digitalen Plattformen oder unterrichten traditionellen Tanz. Wieder andere lassen sich rekrutieren – vom Versprechen schnellen Geldes, von der Faszination der Waffen, von der Hoffnung, der Armut zu entkommen. »Die Medien und sozialen Netzwerke lehren sie Konsum, nicht Identität«, sagt Tenorio. Es sei in Ordnung, von anderen Kulturen zu lernen – aber die Indigenen müssen auch wissen, wer sie sind und ihre Identität bewahren.
Genau deshalb betreiben die indigenen Völker des Cauca ihr eigenes Bildungssystem. In den Territorien stehen indigene Schulen, in denen neben Mathematik und Biologie auch indigene Sprachen und Weltanschauungen gelehrt werden. Die Kinder lernen, wie man mit dem Land lebt, nicht gegen das Land. In Popayán gibt es die Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Dort wird indigene Kosmovision wissenschaftlich gelehrt, die Abschlüsse sind staatlich anerkannt. Professoren reisen regelmäßig in die Territorien, damit auch diejenigen studieren können, die wegen der Feldarbeit nicht wegkönnen. Bildung ist Teil der Verteidigung.
Neues Verhältnis zum Militär
»Wir zeigen der Jugend einen Weg zum Frieden«, sagt Tenorio. Die Guardia funktioniert dabei wie eine Schule des Handelns. Mehr als 10 000 Freiwillige gehören ihr an: Männer, Frauen, Kinder. In Schulungen lernen sie ihre Rechte kennen, lernen deeskalieren, verhandeln, vernetzen. »Wir setzen rote, grüne und weiße Flaggen, um zu signalisieren: Das ist indigenes Territorium – bewaffnete Gruppen haben hier nichts verloren.«
Auch gegenüber dem Militär hat sich das Verhältnis verändert. Früher gab es keine Präsenz, heute stehen Soldaten wieder in den Dörfern. Doch es gibt Gespräche. »Wir fordern keinen Rückzug des Militärs«, sagt Tenorio. »Aber wir verlangen, dass sie sich strikt an die Verfassung und das internationale Recht halten und keine Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausüben. Die Kommunikation mit der Armee hat sich seit Präsident Petros Amtsantritt deutlich verbessert.«

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Der Cric, gegründet 1971, ist heute eine der stärksten indigenen Organisationen Lateinamerikas. Von fünf ursprünglichen Autoritäten wuchs die Bewegung auf 138. In Bogotá betreibt sie ein eigenes Büro, nahe dem Regierungsviertel. Bei nationalen Protesten ist ihre rot-grüne Flagge immer zu sehen. Viele bewundern ihre Disziplin. Ein indigener Abgeordneter aus Indonesien zeigte sich bei dem Forum im Juni beeindruckt vom Zusammenhalt des Cric. Er wünsche sich diese Organisation auch für sein Volk.
Widerstand durch Beharrlichkeit
Dass in den vergangenen Wochen keine Indigenen verletzt worden sind, sei vor allem der Wachsamkeit der Guardia Indígena zu verdanken, erklärt Tenorio. Oft könne sie dank ihrer Erfahrung, ihrer Einschätzung der Lage und eines funktionierenden Frühwarnsystems schon im Vorfeld erkennen, wann und wo Anschläge drohen.
Doch mitten in diesem Widerstand flammt die Gewalt erneut auf. Seit dem Attentat auf den rechten Präsidentschaftskandidaten Miguel Uribe Turbay Anfang Juni in Bogotá habe sich die Lage im Cauca weiter zugespitzt – und das, so Tenorio, sei kein Zufall. Wenn die kolumbianische Rechte in den 1940er Jahren Jorge Eliécer Gaitán habe ermorden können, wenn sie Carlos Pizarro habe töten können, dann traue man ihr auch heute alles zu. Die jüngste Eskalation sei Teil einer bewussten Strategie, um Unsicherheit zu erzeugen und autoritäre Politik gesellschaftlich wieder anschlussfähig zu machen. Es gebe, so meint er, eine Allianz des Schweigens zwischen rechten Kräften, illegalen Gruppen und ökonomischen Eliten.
Die indigene Bewegung widersetzt sich dieser Logik. Nicht durch Waffen, sondern durch Beharrlichkeit. »Wir sind weder rechts noch links«, sagt Tenorio. »Wir sind autonom.«
Platz auch für die Kleinsten
Mauricio Capaz, Menschenrechtskoordinator der Guardia, bringt es auf den Punkt: »Im Cauca gab es Gewalt unter rechten Regierungen und jetzt auch unter der ersten progressiven. Bisher hat man es nicht geschafft, den bewaffneten Gruppen die Kontrolle über die Territorien zu entziehen.« Gleichzeitig ruft er zur Besonnenheit auf: »Wir rufen dazu auf, kühlen Kopf zu bewahren. Kolumbien hat viele Epochen der Gewalt erlebt. Wichtig ist, dass wir unsere Ziele friedlich weiter verfolgen – unabhängig von der politischen Farbe der Regierung.«
Neben einem Wächter steht ein kleines indigenes Mädchen. Auch sie trägt eine blaue Weste wie die Erwachsenen – und in der Hand hält sie ihren selbst verzierten bastón: kein Spielzeug, sondern Symbol der Zugehörigkeit. In der Guardia haben auch die Kleinsten ihren Platz.
Der Handel in der Markthalle geht weiter. Und mit ihm die indigene Tradition – und der Widerstand.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.