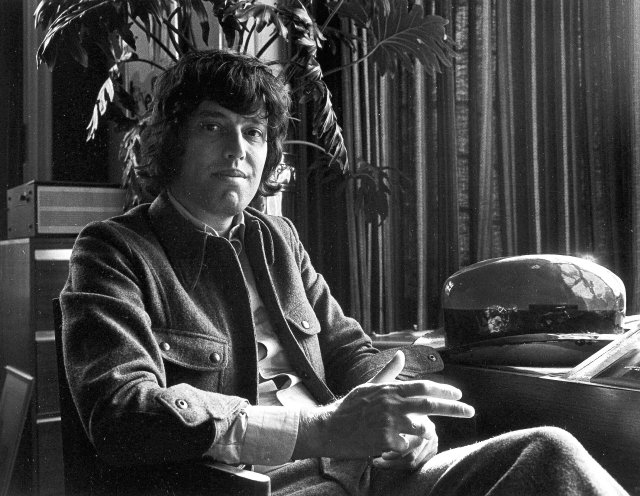- Kultur
- Schostakowitsch
Blick in die Zukunft
Anmerkungen zu Dmitri Schostakowitsch zum 50. Todestag (Teil 2)

Schostakowitsch stellte sich auf die Seite der Russischen Revolution. Davon legt die 11. Sinfonie op. 103 mit dem Titel »Das Jahr 1905«, die im Mai beim Leipziger Schostakowitsch-Festival vom Boston Symphony Orchestra unter Andris Nelsons erklang, eindrucksvoll Zeugnis ab. Das Werk erinnert an den Petersburger Blutsonntag vom 9. Januar 1905: In den Maschinenfabriken, Werften, Manufakturen und Webereien fand ein Generalstreik statt, und an besagtem Sonntag zogen Zehntausende von Arbeitern, unterstützt von weiten Teilen der Zivilbevölkerung Petersburgs, vor den Winterpalast des Zaren, um für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Agrarreformen, die Abschaffung der Zensur, aber auch für die Schaffung einer Volksvertretung zu demonstrieren. Im 1. Satz seiner Sinfonie, »Platz vor dem Palast«, hat Schostakowitsch eine seiner schönsten Musiken geschrieben, was natürlich keine Überraschung ist, denn was gibt es Wunderbareres als Zehntausende von Menschen, die gegen die Tyrannei für ihre Rechte eintreten? Doch die erste, oder sollen wir sagen: ursprüngliche, Russische Revolution von 1905 wurde vom zaristischen Militär auf brutalste Weise niedergeschlagen.
Gedämpfte Pianissimo-Klänge der Streicher, Quinten und Oktaven, unterstützt von Harfen, verleihen dem Auftakt der Sinfonie etwas Zauberisches. Der Sound, den Andris Nelsons in Leipzig eindrucksvoll beschwor, erinnert an die herrliche Morgendämmerung, mit der Mussorgskis »Chowantschina« beginnt, auch dies ein musikalisches Volks-Drama (und hier wie da spielen Glocken eine gewichtige Rolle). Bei Schostakowitsch hören wir ein viertöniges Motto der Pauke, Fanfarenrufe der gedämpften Trompeten, liturgische »Herr, erbarme dich unser«-Bitten der Streicher leiten zu einem Revolutionslied über. Man kann das statisch nennen, aber mir scheint dieser Satz so, wie er in Leipzig erklang, eher von banger Erwartung zu strotzen, die gespannte Atmosphäre voller Unsicherheit angesichts des großen Wagnisses zu reflektieren, das Arbeiter und Bevölkerung bei ihrem Protest gegen den Zaren eingehen.
Im 2. Satz erhebt sich die Demonstration, bis die Soldaten des Zaren auf die wehrlosen Menschen schießen, wir hören gnadenlos tosendes Blech und Schlagwerk: Feuer auf die friedlichen Demonstranten, Gewehrsalven, Perkussionsdonner. Eine letzte Trompetenfanfare, das Revolutionslied in den Flöten, das Pauken-Motiv des 1. Satzes kehrt zurück und leitet in das große Adagio des 3. Satzes über, »In Memoriam«, ewiges Gedenken. Ein Trauermarsch, in dem Schostakowitsch das Arbeiterlied »Unsterbliche Opfer« einbaut. Und im letzten Satz ein furioses Sturmgeläut, Andris Nelsons ließ es knallen, das ist ein Blick in die Zukunft, eine verbissene Hoffnung auf politische Veränderung, ohne die Verzweiflung angesichts des Massakers an den Demonstrierenden auszublenden.
Am Ende von wilden Trommeln begleitetes fortissimo-Glockengeläut, immer abwechselnd zwei Takte in der g-Moll- und der G-Dur-Terz, also den Ausgang offenlassend. Im Leipziger Programmheft nannte es Ann-Katrin Zimmermann ein »wortloses Verkündigungspathos«: Die heftigen Glockenschläge »rufen zusammen und kündigen etwas Großes, Bedeutsames« an. Die Oktoberrevolution, »Das Jahr 1917«, also Schostakowitschs 12. Sinfonie?
Erschienen ist die 11. Sinfonie im Jahr 1957, vier Jahre nach dem Tod Stalins. In den Fake-Memoiren von Schostakowitsch, die Solomon Volkov 1979 in den USA und der BRD veröffentlichte, soll der Eindruck erweckt werden, der Komponist habe damit an den ungarischen Volksaufstand im Jahr 1956 erinnern wollen. Andere meinen, das Werk zeuge von der Unterdrückung der Menschen durch den Diktator Stalin. Dabei scheint es auf der Hand zu liegen, dass die Sinfonie, deren Aufführung für den 40. Jahrestag der Oktoberrevolution von 1917 geplant war, sich eher auf die Wurzeln der bolschewistischen Revolution bezieht, eben auf das Jahr 1905, als die erste Russische Revolution noch nicht siegreich sein konnte.
Zweifelsohne kann man das Werk auch einfach als Fanal gegen Unterdrückung, gegen Gewalttaten an Wehrlosen hören. Parallel zu der eindrucksvollen Aufführung im Gewandhaus konnte man im Frühjahr im Leipziger Museum der Bildenden Künste die nicht minder eindrucksvolle Bernhard Heisig-Sonderausstellung »Geburtstagsstilleben mit Ikarus« mit seinen albtraumhaften Gemälden (»Als ich die Völkerschlacht malen wollte«) und den Antikriegs-Lithografie-Mappen (»Probleme der Militärseelsorge«, »Marschierende Soldaten auf dem Schlachtfeld«) betrachten.
Die Siebte und Elfte sind ganz sicher Programmmusik. Sie enthalten Einblicke in Schostakowitschs Kompositionsweise in nuce. Man wird Schostakowitsch nicht ohne Gustav Mahler denken können: Das von Mahler erfundene »Sampling«, also das Nebeneinanderstellen unterschiedlichster Motive, ohne diese auszuarbeiten; das Verwenden von Motiven aus Alltagsmusiken, Volks- oder Revolutionsliedern gibt es auch bei Schostakowitsch. Bei ihm sind es immer wieder jüdische Melodien und Lieder, was auch ein Statement gegen den latenten Antisemitismus nicht nur der Stalin-Zeit darstellt. Da sind die großen Orchester, die gewaltige Klangwelten auf die Zuhörer*innen niederdröhnen lassen, die aber auch so leise spielen können müssen, dass die Musik kaum noch hörbar ist. Beeindruckend der Hang zur Übertreibung, zu ins Groteske überführten Scherzi; nicht zuletzt auch der Mut, Sinfonien dann, wenn es nötig ist, einfach verklingen und geradezu ersterben zu lassen, statt ein mutwilliges Finalfurioso vom Zaun zu brechen – wobei ihm wie auch Mahler furiose Orchestertutti und Blechbläser- oder Schlagwerk-Attacken keineswegs fremd sind. Und kein Zufall, dass einer der größten Schostakowitsch-Dirigenten, Kirill Kondraschin, sein Freund und Dirigent einiger Uraufführungen, auch ein hervorragender Mahler-Interpret war.
Nehmen wir Schostakowitschs 4. Sinfonie c-Moll op. 43, die 1935/36 komponiert, aber erst 1961 von Kondraschin uraufgeführt wurde. Der Komponist hatte sie am Vorabend der geplanten Premiere aufgrund einer Warnung, sie würde einen neuerlichen Skandal entfachen und könnte ihm gefährlich werden, zurückgezogen, und auch die vierhändige Klavierversion, die der Komponist 1945 mit seinem Freund Mieczyslaw Weinberg vor dem Moskauer Komponistenverband aufführte, fand keine offizielle Unterstützung.
In der Vierten erleben wir katastrophische Weltuntergänge und Zerfall im Chaos. Das Orchester marschiert Mahler-haft drauflos. Eine mächtige Tamtam-Wand. Übrig bleibt – eine einsame, wehklagende Fagottmelodie. Später dann ein Englischhorn, das sich in seiner melodiösen Zaubrigkeit mit der alten Hirtenweise zu Beginn des dritten Akts von Wagners »Tristan« misst. Es gibt eine furiose Streicher-Fuge, Fanfaren und geradezu gewalttätige Schlagwerk-Teufeleien. Eine Groteske. Die sechs Flöten mit schrillen, in den Ohren schmerzenden Tönen. Und schließlich ein endlos stehender, ersterbender Akkord. Leise Paukenschläge. Das Skelett einer Melodie. Die Celesta und ein letztes c-Moll.
Diese Sinfonie ist ein Wunderwerk, erst recht, wenn sie so großartig aufgeführt wird wie in Leipzig vom Gewandhausorchester unter Andris Nelsons, der ja nicht nur Chefdirigent der Boston Symphony, sondern zugleich Gewandhauskapellmeister ist. Hier spürte man die Leipziger Schostakowitsch-Kompetenz, die spätestens seit der weltweit ersten zyklischen Aufführung aller Schostakowitsch-Sinfonien unter Kurt Masur von 1976 bis 1978 besteht (damals wurden die Werke übrigens in Beziehung zu Beethovens Sinfonien gesetzt).
Online sind auch Teil 1 und Teil 3 von Berthold Seliger zu Schostakowitsch abrufbar.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.