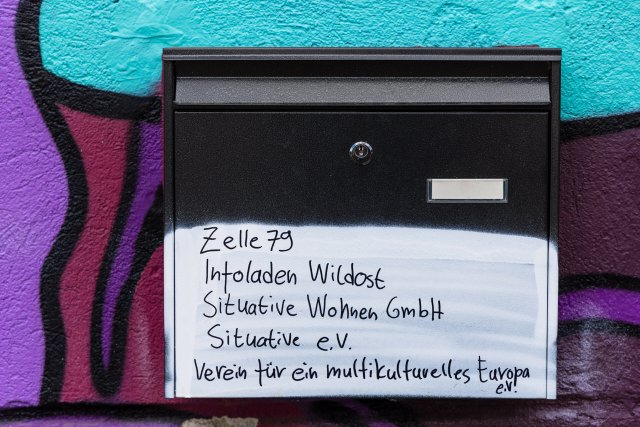- Berlin
- Artenschutz
Brandenburg ruft zur Wolfsjagd
Das Umweltministerium will zum Wolfsmanagement 15 Prozent der Raubtiere entnehmen lassen

Wie umgehen mit dem Wolf? Brandenburg hat deutschlandweit die höchste Wolfsdichte. Wenn man Agrarstaatssekretär Gregor Beyer (parteilos), der politisch für das sogenannte Wolfsmanagement zuständig ist, folgt, sogar weltweit. Das Land Brandenburg will nun den Wolf noch dieses Jahr ins Jagdrecht aufnehmen und per Quote jährlich 15 Prozent der Tiere »entnehmen«, also von Jäger*innen schießen lassen. Diese Quote könnte auf 35 Prozent steigen. Das teilte das Umweltministerium mit.
Mit dieser Maßnahme will das Ministerium den Bestand managen. »Richtig ist, dass man, wenn man einen Bestand an Wildtieren auf gleicher Bestandshöhe halten will, bezogen auf die Wolfsbestände jährlich ungefähr ein Drittel des Bestandes (…) entnehmen muss«, so das Ministerium. Allerdings müsse man in den ersten Jahren »mit extremer Vorsicht« vorgehen. Ziel sei nicht nur die Begrenzung, sondern auch die Erhaltung des Wolfsbestandes.
Wie viele Wölfe nach dem Willen des Ministeriums geschossen würden, hängt dann folgerichtig davon ab, wie viele Wölfe es in der Mark gibt. Darüber eröffnet das Ministerium eine Debatte: »Realistisch erscheint, dass der Wolfsbestand mindestens 1000, wahrscheinlich aber 1500 bis 1600 Tiere beträgt.« Im sogenannten Wolfsmonitoring wird in Brandenburg allerdings nicht die Zahl an Wölfen ermittelt, sondern wie viele Rudel es im Land gibt. Das dem Umweltministerium unterstellte Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) geht von 58 Rudeln aus. Das Ministerium kritisiert diese Zählweise. Sie sei »international eingeschätzt« ungenügend.
Axel Kruschat, Landesgeschäftsführer der Naturschutzorganisation BUND, hält die Berechnung des Ministeriums für falsch. »Die Zahlen, die Staatssekretär Beyer präsentiert, sind komplett aus der Luft gegriffen«, sagt er im Gespräch mit »nd«. Es gebe im Land ein »solides Wolfsmonitoring«, das im Handstreich beiseite geschoben werde. Viel realistischer sei eine Zahl von maximal 600 Wölfen in Brandenburg.
Die Zahl der Wölfe in Brandenburg ist nicht nur für potenzielle Abschusszahlen relevant, sondern auch für die Bewertung, welchen Erhaltungszustand die Population hat. Der Erhaltungszustand bezeichnet, ob eine Art in einem Lebensraum auch langfristig nicht vom Aussterben bedroht ist. Zuletzt wurde dies als »unbekannt« an die EU gemeldet. Staatssekretär Beyer hatte, dieser Stellungnahme widersprechend, zuletzt betont, dass er davon ausgehe, die Wolfspopulation im Land befinde sich in einem »günstigen Erhaltungszustand«.
Auch hier widerspricht BUND-Sprecher Axel Kruschat. Die Wölfe in Brandenburg könnten nur überleben, wenn die Mortaliät nicht steigt, so der Umweltexperte. »Bei großen Säugetieren braucht es mindestens 500 Individuen, um eine Population zu halten.« Wenn man jetzt nach Quotenregelung, ausgehend von künstlich überhöhten Zahlen anfange, Wölfe zu schießen, nähere man sich dieser Zahl, so Kruschat. »Dadurch wird ein Wiederaussterben höchst wahrscheinlich.«
Wölfe sind eigentlich streng geschützt. Nicht nur durch EU-Recht, sondern auch durch die Berner Konvention. Der Erhaltungszustand dürfe nicht verschlechtert werden, so Kruschat. Dementsprechend seien die jetzt erklärten Absichten des Ministeriums rechtswidrig, so Kruschat. »Jeder Jäger, der sich an einer Quotenjagd beteiligt, gefährdet seine Jagderlaubnis.«
»Realistisch erscheint, dass der Wolfsbestand mindestens 1000, wahrscheinlich aber 1500 bis 1600 Tiere beträgt.«
Umweltministerium Brandenburg
Dass trotz der strengen Schutzbestimmungen über den Abschuss von Wölfen nachgedacht wird, liegt vor allem daran, dass sie immer wieder Nutztiere reißen. Das sorgt bei Landwirten für Unmut. 2024 gab es laut dem LfU 279 sogenannte »Schadensereignisse«, bei denen der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen wurde. Dabei wurden 1047 Nutztiere getötet, zu großen Teilen Schafe und Ziegen.
Die Risszahlen gehen allerdings zurück. 2023 waren es noch 358 Schadensereignisse mit insgesamt 1465 getöteten Nutztieren. Dass es immer noch Risse gebe, erkläre sich hauptsächlich durch noch immer nicht flächendeckend umgesetzte Herdenschutzmaßnahmen, insbesondere auch in den Gebieten, in denen es schon lange Wölfe gebe, so das LfU. Darauf verweist auch Axel Kruschat: »Mehr als zwei Drittel der Nutztierrisse fanden bei komplett ungeschützten Herden statt.«
»Dass es dennoch weniger Risse gegeben hat, liegt vor allem daran, dass sich langsam herumspricht, dass sich Herdenschutz lohnt«, so Kruschat. Denn dort, wo dieser umgesetzt werde, sinke auch die Zahl der Risse stark. Anstatt sinnlose Diskussionen über Abschussquoten zu führen, sollten die Förderrichtlinien vereinfacht werden und darüber geredet werden, wie man die oft prekäre wirtschaftliche Situation der Weidetierhalter verbessern könne, so der Geschäftsführer des BUND-Landesverbandes. »Es ist abstrus: Auf der einen Seite wird der Wolf zu einem riesigen Problem gemacht, auf der anderen Seite werden Weidetierhalter hingehalten«, so Kruschat. »Auch wenn die eigentlich rechtswidrige Quotenjagd kommen sollte, müssen Herden geschützt werden, vielleicht sogar noch mehr.«
Denn der BUND-Sprecher erwartet sogar, dass eine Quotenjagd die Situation für Weidetierhalter noch verschlimmern könnte. Wenn man die Rudelstrukturen zerstöre, werde es mehr sogenannte »Problemwölfe« geben. »Dadurch sinkt die Jagdkapazität der Rudel. Die suchen sich dann leichtere Beute – wie eben ungeschützte Tiere auf der Koppel.«
Im RBB kündigte Umweltstaatssekretär Beyer an, dass man auch gegen Problemwölfe vorgehen wolle. Dazu soll es in Zukunft möglich sein, Kadaver gerissener Weidetiere für zwei Nächte von Jäger*innen bewacht liegen zu lassen. So soll ermöglicht werden, Nutztiere reißende Problemwölfe zu entnehmen. Mit diesem Vorgehen geht auch der BUND konform. »Das ist seit Jahren ein Kompromissangebot der Umweltverbände«, so Kruschat. Diese Maßnahme mit der Quotenjagd zu vermengen, sei allerdings »perfide«. »Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.«
Die Debatte ist noch längst nicht abgeschlossen – und wird im September weitergeführt. Dann will das Umweltministerium ein »großes Wolfsplenum« mit vielen Verbänden abhalten. Die Entnahmequote wird dort ein zentrales Thema sein.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.