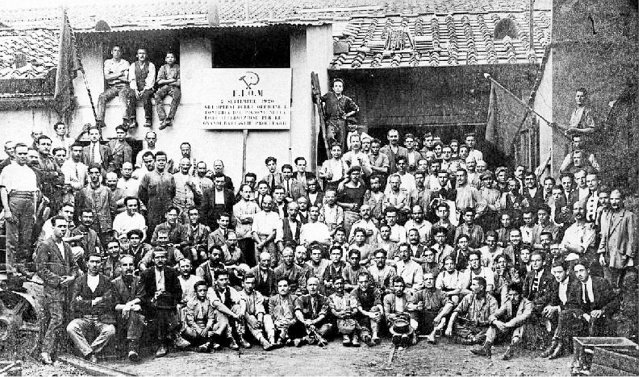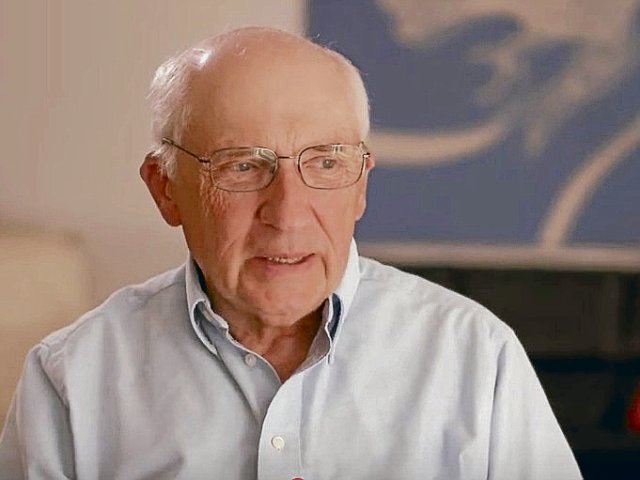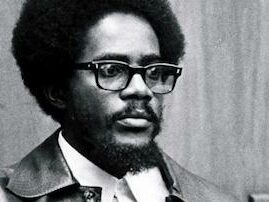- Kultur
- Christian Baron
»Drei Schwestern«: Raus aus der Malocherhölle
Dramatische Szenen, starke Charaktere: Christian Barons Roman »Drei Schwestern« über die 80er in der alten Bundesrepublik

Lesend sieht man einen Film vor sich und wünscht sich, aus dem Roman könnte einer werden. Unter die Haut geht einem gleich zu Beginn die Szene, als die 15-jährige Mira sich im Krankenhaus von ihrem totgeborenen Kind verabschieden muss. Und dann tritt ein Kerl mit roter Tolle und schwarzer Lederjacke durch die Tür. Sanft streichelt er ihr über den Kopf und »lächelt milde aus seinen meerblauen Augen«, obgleich er nicht der Vater der kleinen Nunzia ist.
Mira und Ottes, bevor Christian Baron geboren worden war: In seinem autobiografischen Roman »Ein Mann seiner Klasse« habe ich sie ganz anders kennengelernt. »Unsere Eltern schliefen direkt neben unserem Zimmer. Darum drang es dumpf bis zu uns, wenn Mamas Kopf gegen die Wand donnerte. Niemals verloren wir darüber ein Wort. Wir spürten den Schmerz, wir betrachteten unsere zitternden Hände, wir warfen einander Blicke zu. Das Flehen und Flennen wurde uns mit der Zeit zur Normalität.«
Und nun versuche ich, diese Bilder zusammenzubringen: Mira, die voller Unternehmungslust im roten Abendkleid und roten Pumps zur Kaiserslauterner Maikirmes geht und sich beinahe noch in einen anderen verliebt, mit der verhärmten Mutter, die schließlich an Krebs stirbt. Und vor allem: Wie konnte aus diesem Ottes so ein Schläger werden?
Bereits in »Schön ist die Nacht«, dem zweiten Teil seiner »Kaiserslauterner Trilogie«, ist Baron in die Zeit vor seiner Geburt 1985 zurückgegangen, indem er den Lebenswegen seiner Großväter folgte. Dieser Roman lebte vom Bemühen zu verstehen, was seinen Vater prägte, dem er zunächst nicht verzeihen konnte, vor dem er sich verschloss. Nun aber lässt er ihn in sein Herz.
»Denn mein wichtigster Impuls zum Schreiben ist etwas, das in der Gegenwart leider aus der Mode kommt: Ich will verstehen.« Das sagt er im Band »Um sein Leben schreiben – Texte zu Herkunft und Zukunft« (2023). Aber das neue Buch lebt nicht vom Essayistischen, das der Autor brillant beherrscht, sondern vom sinnlichen Eindruck. Von einem, wie gesagt, filmreif ausgemalten Ambiente, immer wieder unterlegt mit der Popmusik der 80er Jahre. Woher nur kennt er die damalige Atmosphäre so genau? Er hat recherchiert, viel von seinen Tanten Juli und Ella erfahren, von Bekannten der Mutter, die jetzt erst Anfang 60 wäre. Und er hat sich eingefühlt, von allzu einfachen Wertungen Abschied genommen. Juli und Ella sind nun viel differenzierter gezeichnet, auch was die Konflikte zwischen ihnen betrifft. Den versteckten Neid, weil Mira so schön ist und Ella den ärmlichen Verhältnissen entfliehen konnte.
»Asoziales Gör … Weißt du, was der Pöbel ist?«, hatte die Lehrerin zu Mira gesagt. Diese Frau Lohmark war »vor acht Jahren aus der DDR geflohen« und gefiel sich nun in einem Standesdünkel, auf den man nur mit Zorn und Stolz reagieren konnte, wenn man nicht in Scham versinken wollte. Mit Carson McCullers Roman »Das Herz ist ein einsamer Jäger« in der Tasche ist Mira dann mal nach Westberlin abgehauen, fand in einer Kreuzberger Hinterhof-Kommune Unterschlupf, bevor Ottes sie zurückholte. Da führt Baron einem auch die »uniforme Masse der Gegenkultur« vor Augen, den Beginn der Grünen mit Petra Kelly, die auf die Forderung »Wir müssen kriegstüchtig werden« so reagierte, wie man es auch heute sollte.
Hier ist das Kunststück gelungen, unterschwellig Heutiges ins Buch zu bringen und zugleich ganz in der Realität der 80er Jahre zu bleiben. Dramatische Szenen, starke Charaktere, zu denen unbedingt auch die kommunistische Großmutter Hulda gehört, eingebettet in geistiges Schwingen, das sich beim Lesen überträgt. »Drei Schwestern«, der Titel lässt an Anton Tschechows Drama denken. Drei Generalstöchter, die sich in der Provinz einen Aufbruch erträumen und nach dem Sinn ihres Lebens fragen: Ella, Mira und Juli, die das Stück im Pfalztheater sehen, sind mit viel härteren Umständen konfrontiert. Befreiung aus »der Malocherhölle«: durch Heirat wie bei Ella, durch Risikobereitschaft wie bei Juli, die mit ihrem Mann eine Videothek namens »Filmhöhle« eröffnet, oder durch harte Arbeit wie bei Christian Barons Eltern.
»Eher krepier ich jämmerlich, als auch nur einmal von Stütze zu leben«, sagt Ottes. Zunächst wirkt er wie ein Filmheld, später wird er immer wieder ausrasten im Suff, weil er es trotz Schufterei auf keinen grünen Zweig bringt. Gewalt lebten die Eltern im Persönlichen aus. Wie anders wäre ihr Weg in der DDR gewesen, überlegte ich beim Lesen. Die Lektüre versetzte mich in ein anderes Land.
Und im Schlusskapitel ein Sprung zurück, als Juli drei Jahre alt ist und Mira sechs. Eine Frau wird erwartet, die »leider die Familie im Stich gelassen habe, vor vielen Jahren«: Ella. »Hallo, ihr beiden. Schön, euch kennenzulernen«, begrüßt sie die Kinder. Die Mutter stank nach Schnaps. Der Fischeintopf schmeckte nicht, der »Käskuchen« war verbrannt und es sah aus »wie bei Mansons unterm Sofa«.
Scham und Beklemmung: Was alles nicht gut ist, spürt schon ein Kind. »Der Mensch ist frei geboren«, sagt Mira, als Oma Hulda und der Vater ihr Ottes ausreden wollen. Immer wieder versuchen, sie selbst zu sein, das kann sie, aber nicht die »Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.
Christian Baron: Drei Schwestern. Roman. Claassen. 350 S., geb., 24 €.
Literatursalon mit Christian Baron am 22. Oktober, 18 Uhr, im Haus am Berliner Franz-Mehring-Platz 1.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.