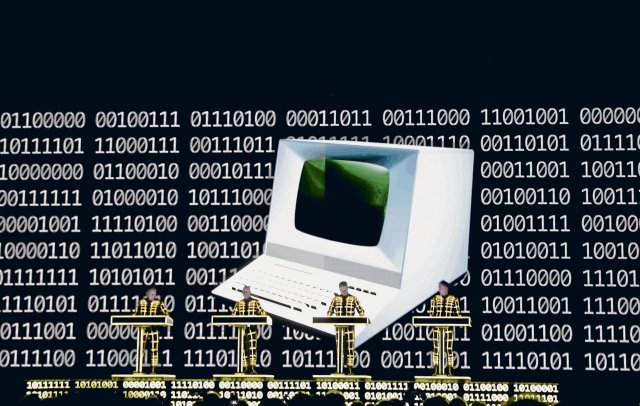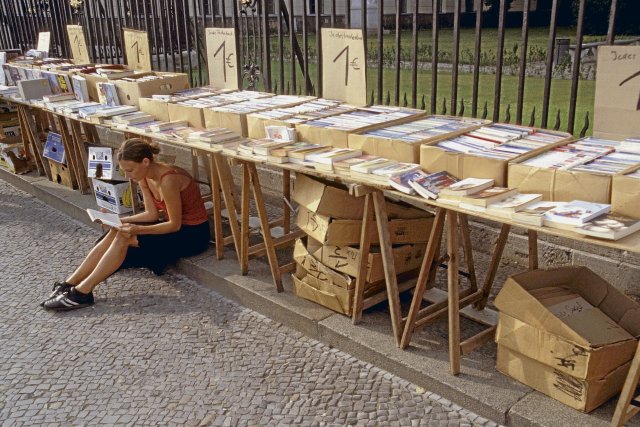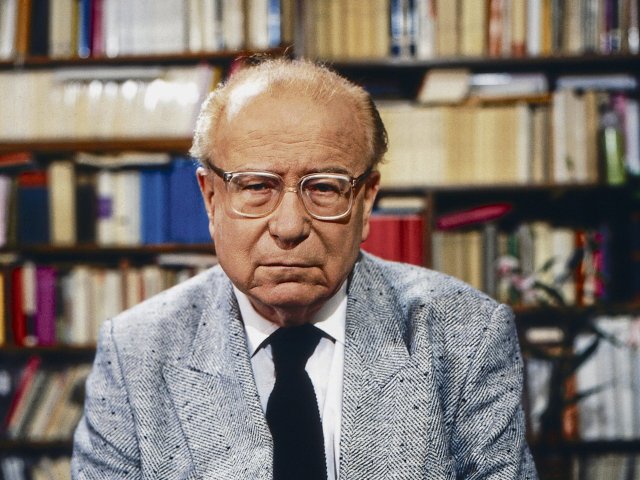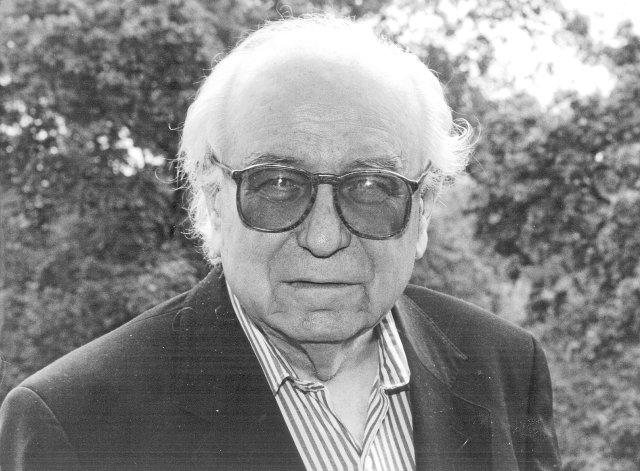- Kultur
- Filmkunst
Das Vergangene ist nicht tot ...
Vier Frauen aus 100 Jahren auf einem Hof: »In die Sonne schauen« verschränkt Vergangenheit und Gegenwart

Es kommt ja nicht so häufig vor, dass ein deutscher Film den Hauptwettbewerb in Cannes eröffnet. Selten genug werden überhaupt deutsche Filme dorthin eingeladen, und noch seltener bringen sie die Augen der Kritiker zum Leuchten. Das letzte Mal gelang das Maren Ade 2016 mit »Toni Erdmann«. Mit seinem subtilen Humor war das ein sehr undeutscher Film über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung. »In die Sonne schauen« von Mascha Schilinski überzeugt nun nicht durch flirrende Leichtigkeit oder überbordenden Humor; im Gegenteil: Ihr Film greift tief in den Besteckkasten der deutschen Romantik, mit all ihrer gefühlstiefen Erdenschwere. Und diese Bodenständigkeit ganz im Wortsinne ist Voraussetzung für einen der aufregendsten Filme der letzten Zeit. Schilinski gewann damit den Preis der Jury in Cannes.
Aufregend ist dabei weniger eine packende Handlung – die gibt es nämlich gar nicht. »In die Sonne schauen« folgt keiner klassischen Erzählstruktur, sondern ist vielmehr etwas, das die Macher als einen »assoziativen Erinnerungsstrom« durch die Zeitläufte bezeichnen. Schauplatz ist ein jahrhundertealter Vierseithof in der Altmark; diesen Raum wird der Film in den zweieinhalb Stunden Laufzeit nicht verlassen. Im Mittelpunkt stehen vier Mädchen, die im Laufe von 100 Jahren zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systemen und Zusammenhängen auf dem Hof gelebt haben oder noch leben und deren Schicksale auf wundersame Weise miteinander verwoben zu sein scheinen.
Zu Beginn wird der Zuschauer umstandslos in das Geschehen geworfen, als die halbwüchsige Erika (Lea Drinda) mitten im Zweiten Weltkrieg heimlich den schlafenden kriegsversehrten Onkel mit seinem Beinstumpf beobachtet und dessen Krücken ausprobiert. Während sich das Mädchen in erotischen Fantasien verliert, bleibt die Arbeit liegen, was ihr schließlich Schläge des Vaters einbringt. In der folgenden Szene treffen wir Alma (Hanna Heckt), die als Kind einer Gutsbesitzerfamilie kurz vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Hof lebt.
In den 80er DDR-Jahren ist es die pubertierende Angelika (Lena Urzendowsky), deren erwachende Sexualität zu Verwerfungen innerhalb der Familie führt. In der Gegenwart schließlich wird der Hof nach längerem Leerstand von einer großstadtmüden Berliner Künstlerfamilie renoviert. Deren Tochter Nelly (Zoë Baier) wächst in scheinbarer Gen-Z-Sorglosigkeit heran; den mythischen Schichten der Vergangenheit, die auf dem Hof lasten, kann aber auch sie sich nicht entziehen.
Jeder hat sich gewiss schon einmal gefragt, was in den eigenen vier Wänden wohl früher alles vorgefallen sein mag, welche Menschen dort gewohnt und was für Schicksale sich hier abgespielt haben mögen. Das ist ungefähr der Grundgedanke, der Schilinski und ihre Ko-Autorin Louise Peter umtrieb, als sie diesen Vierseithof in einem kleinen altmärkischen Dorf entdeckten und dort dann in den stillen Corona-Jahren das Drehbuch schrieben. »Drehbuch« ist freilich ein Euphemismus, denn eine aufeinander aufbauende oder gar lineare Handlung gibt es nicht. Der Hof ist der eigentliche Protagonist des Films; er ist Grundlage und Voraussetzung für das Leben, das seine Bewohner aus vier Generationen dort führen.
Der subjektive Blick der Darstellerinnen prägt den Film ebenso wie die episodische Struktur, die assoziativ und scheinbar willkürlich durch die verschiedenen Zeiten hin und her springt und jedes Mal einen Ausschnitt aus dem Leben der Mädchen zeigt. Erst allmählich schält sich ein Narrativ heraus, werden Entwicklungslinien und Zusammenhänge deutlich, beginnen die einzelnen Episoden sich aufeinander zu beziehen, Geschichte(n) zu erzählen und verweben so das Geschehen auf dem Hof zu einer epischen Erzählung.
In der Philosophie herrschte lange die Auffassung, dass der Mensch bei der Geburt ein vollkommen unbeschriebenes Blatt ist und die Matrix unseres Lebens erst durch Erleben, Bildung, Erziehung und frühkindliche Prägungen geformt wird. Dem widerspricht Schilinski entschieden; sie erzählt davon, wie die existenziellen Erfahrungen, die Erlebnisse und Traumata unserer Vorfahren in den Körpern und Seelen der Nachgeborenen Spuren und Verhärtungen hinterlassen, die sie unbewusst durch das Leben begleiten und ein unsichtbares Netz bilden, dessen Fängen kaum zu entkommen ist.
Das kann man ziemlich esoterisch finden, aber selbst der härteste Materialist wird manchmal, vielleicht im Traum, dieses Raunen der Zeit(en) vernehmen, das nicht Greifbare, Schwebende, Ambivalente unseres Daseins. Außerdem weiß die Wissenschaft heute auch, dass eine Persönlichkeit tatsächlich nicht nur durch ihre gegenwärtigen Lebensumstände geprägt wird, sondern erfahrene Traumata durchaus über mehrere Generationen vererbt werden können, sich sozusagen in die Gene einbrennen.
Das »unbeschriebene Blatt« gilt als überholt. Diese Lesart ist zwingende Voraussetzung für den Film, in dem die Schatten der Vergangenheit wie eine Folie auf den nachfolgenden Generationen liegen, deren Wahrnehmung determinieren und ein Muster von Wiederholungen schaffen.
Nicht zuletzt ist »In die Sonne schauen« ein Film über Frauen und ihre Rolle im sozialen Gefüge, die im Laufe des letzten Jahrhunderts eine dramatische Umdeutung erfahren hat. Mägde, die nichts weiter sein dürfen als lebendes Inventar, Familienstrukturen voller Gewalt gegenüber Frauen und die brutale oder wenigstens lieblose Erziehung der Kinder – das erinnert alles an Michael Hanekes »Das weiße Band«, eine Parabel auf die Ursprünge des Faschismus. Von Freudlosigkeit ist in den späteren DDR-Jahren nichts mehr zu spüren und Gleichberechtigung erkennbar mehr als nur eine Phrase. Wie die Frauen selbstbewusst »ihren Mann stehen«, zeugt das von gesellschaftlichen Umbrüchen, die freilich nichts an der Brüchigkeit der Familienverhältnisse ändern.
Für die 1984 geborene Mascha Schilinski ist »In die Sonne schauen« ihr zweiter Spielfilm nach »Die Tochter« (2017). Ihre früheren Erfahrungen als Mitarbeiterin einer Casting-Agentur für Kinder und Jugendliche waren zweifellos Gold wert bei der durchweg überzeugenden Besetzung der Hauptrollen. Überhaupt erstaunt, mit welcher von Lebenserfahrung gesättigten Reife und welchem Stilbewusstsein sich Schilinski ihrem Sujet nähert. Was ihr Generationenporträt so einzigartig macht, ist neben seiner offenen Form die raffinierte filmische Umsetzung, die es mit einer assoziativen Montage schafft, dass Traum und Realität nahtlos ineinander übergehen.
Die Zeitebenen zwischen Vergangenheit und Gegenwart lösen sich auf, verschränken sich und flüstern miteinander, während die Kamera durch die Räume schwebt und große Tableaus entwirft. Unterschiedliche Optiken und sogar der Einsatz einer Lochkamera visualisieren diesen Schleier der Erinnerung, während ein ausgefeiltes Sounddesign die Bildebene verstärkt und den Zuschauer tief in die Handlung einbindet. Diese formale Experimentierfreude verlangt dem Publikum anfangs einiges ab, aber schon bald stellt sich Vertrautheit mit den Figuren und deren Innenleben ein.
Wieder loszulassen, scheint dabei selbst der Regisseurin schwergefallen zu sein, sodass der Film aus seinem Reigen aus Liebe, Begehren, Schicksal, Tod, Kindheit und Erinnerung am Ende schwer wieder herausfindet. Eine halbe Stunde weniger wäre mehr gewesen. Das sollte jedoch niemanden abschrecken. Aktuellen Meldungen zufolge wird »In die Sonne schauen« als deutscher Kandidat ins nächste Oscar-Rennen gehen.
»In die Sonne schauen«, Deutschand 2025. Regie: Mascha Schilinski; Drehbuch: Mascha Schilinski/Louise Peter. Mit: Lea Drinda, Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Zoë Baier. 149 Min. Kinostart: 28.8.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.