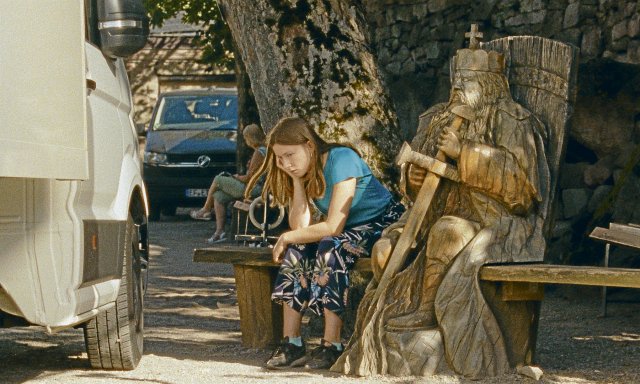- Kultur
- Alfred Hugenberg
Der Führer vor dem Führer
»Nius« ist nichts Neues: Schon der rechte Medienzar Alfred Hugenberg nutzte die Pressefreiheit, um die Demokratie der Weimarer Republik zu zerstören

Das rechtsgerichtete Nachrichtenportal »Nius« war in den letzten Monaten selbst oft Thema in den Nachrichten. Das vom geschassten Ex-»Bild«-Chef Julian Reichelt mit geleitete Portal war eine treibende Kraft bei der Kampagne gegen die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht. Zudem warf ein Datenleak ein Schlaglicht auf die Finanzierung des Portals: Demnach hat »Nius« nur ein paar hundert regelmäßig zahlende Nutzer. Es wird offenbar hauptsächlich vom rechtsgerichteten Unternehmer Frank Gotthardt getragen. Rechte Figuren mit viel Geld, die über die Medienmacht das gesellschaftliche Klima beeinflussen wollen, das hat Tradition: Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch, Elon Musk – oder im vorigen Jahrhundert die Hitlerfreunde Harold Harmsworth in Großbritannien oder William Randolph Hearst in den USA. Das Modell gibt es, solange es Massenmedien gibt. In der Zeit der Weimarer Republik hat ein solcher Medienmogul enorm dazu beigetragen, die Themen und Thesen der Rechtsextremen zu popularisieren: Alfred Hugenberg (1865–1951).
Medienmacht durch die Hintertür
Hugenberg, der die Pressefreiheit nutzen wollte, um die Demokratie abzuschaffen, war von Haus aus ein Außenstehender: Seine ganze Ideologie gründete darauf, dem bestehenden System nicht anzugehören. Wie viele deutsche Nationalisten hatte er seinen Glauben an das deutsche Reich verloren, als Kaiser Wilhelm II. 1890 den deutschen Helden Bismarck aus dem Amt als Reichskanzler entließ. Die enttäuschten Nationalisten suchten nun einen Führer, der aus dem Volk erwachsen und Deutschland zu »neuer Größe« bringen sollte.
Mit gerade einmal 25 Jahren trat nun der Hannoveraner Jurist Alfred Hugenberg auf den Plan und wirkte auf die Gründung des Alldeutschen Verbands hin, einer einflussreichen nationalistischen Agitationsmaschine, die mit Parlamentarismus nicht viel anfangen konnte. Hugenberg tat sich hier als begabter Strippenzieher hervor und erreichte 1909 eine der machtvollsten Positionen, die es in Deutschland gab: Er wurde Vorstandsvorsitzender der Krupp AG, die an der Vorbereitung des kommenden großen Krieges arbeitete.
Als Lobbyist der Rüstungsindustrie und Machtstratege hatte er ein Auge auf die Medien seiner Zeit geworfen. Er suchte nach Möglichkeiten, Deutschlands zerfaserte Zeitungslandschaft in den Griff zu kriegen. Dafür nahm er die Hintertür, sammelte bei den Konzernen Geld und gründete die »Allgemeine Anzeigen Gmbh« (Ala). Diese Agentur kaufte im großen Stil Werbeflächen in den Zeitungen und verkaufte sie an die Industrie, bis sie einen großen Teil des Anzeigenmarkts kontrollierte, also die wesentliche Finanzquelle des Printbusiness. Die Konzerne hinter Hugenbergs Agentur erwarteten dabei keine Gewinne: Was in Hugenbergs Büro investiert wurde, war »Zweckvermögen« – Geld, das eher politisch wirken sollte, statt sich zu vermehren.
Hugenbergs größter Coup war es, die Filmfirma Ufa unter seine Kontrolle zu bringen.
Die Ala kassierte Provisionen und lebte davon gut. Hugenberg war bald auch in der Lage, ganze Zeitungen zu übernehmen. Erst durch den Krieg geschwächt, dann durch die Inflation, waren viele Zeitungen froh, wenn Hugenberg sie rettete. 1927 erklärte er selbst: »Wenn ich Inflationsgewinne gemacht habe, so hat sich das so vollzogen, dass ich schwach werdende Blätter erworben habe, um sie entweder der nationalen Sache zuzuführen oder aber sie auf dem nationalen Gleise zu erhalten.«
Aufbau eines Propagandaapparats
1918 verließ Hugenberg Krupp und wurde Mitgründer einer neuen rechten Partei DNVP, die zur zweitstärksten Kraft heranwachsen sollte (20,4 Prozent bei der Reichstagswahl 1924). In seinem florierenden Medienimperium hatte er nicht nur viele kleine Zeitungen im Portfolio, auch hatte die Industrie ihm den mächtigen Berliner Scherl-Verlag zum Geschenk gemacht. Der saß damals dort, wo sich heute der »Axel Springer Campus« befindet. Hugenberg bewies Weitsicht, indem er früh die »Telegraphen-Union« übernahm, eine hochmoderne Presseagentur, die vielen Zeitungen täglich half, ihre Seiten zu füllen.
Dass er nie Journalist, sondern immer ein Undercover-Machtpolitiker und Ideologe war, verhüllte er kaum. Nach außen hin erschollen unterkomplexe Bekenntnisse im Stil der Zeit, etwa: »Eine wirklich große deutsche Presse kann ihren Kristallisationspunkt nur in einer Persönlichkeit finden. Eine wirklich große Persönlichkeit pflegt aber wiederum Trägerin von Ideen zu sein. Eine solche Idee ist der nationale Gedanke …« Weniger verbrämt erklärte Hugenberg seine Mission in einer Aktennotiz: Sein Konzern sei »materiell im wesentlichen eine Tarnung des Zechenverbandes bzw. Bergbauvereins«, um »in schwerer Zeit einen nationalen Presse- und Propagandaapparat aufzubauen«.
Scherl-Verlag und Hugenberg standen dabei naturgemäß der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) nah, die sich mit anderen rechten Parteien ein Wettrennen um den einzig wahren Führer lieferte. Viele Journalisten wurden dabei aus der Reichswehr übernommen, an arbeitslosen Offizieren herrschte nach dem Versailler Vertrag kein Mangel. Hugenberg besaß Machtinstinkt genug, um für den Erfolg seiner Produkte auch mal das edle Germanentum hintanzustellen. Sein größter publizistischer Erfolg war ab 1922 die »Berliner Nachtausgabe«, später »Berliner (Illustrierte) Nachtausgabe«: Hier wurde mit kecken Fotos gearbeitet und mit neuartig großen, rot unterstrichenen Schlagzeilen. Hugenberg erklärte dazu: »Boulevardblatt ist in allen Großstädten der Welt ein durch besondere Aufmachung wirkendes Blatt – nicht Sonntagsblatt. Sonst kaufen es eben diese Großstädter nicht. Sie kaufen es wegen der Sensation, die darin steht – und nehmen die Politik, die dazwischen steht, mit in sich auf.« Mit den Großstädtern hatte er offenbar weniger Probleme als mit den eigenen Journalisten. Hugenberg 1931 in einem Brief: »Den deutschen Journalisten die Notwendigkeit des Hämmerns beizubringen, ist ungeheuer schwer. Sie sind zuwenig Propagandisten.« Die Themen seiner Propaganda waren dabei die völkischen Evergreens: »Zurück zu Bismarck« (beziehungsweise einem »neuen Bismarck«), gegen Sozialpolitik, für »Rassenkunde und Rassengeschichte«, gegen Juden, gegen die »Schmach von Versailles«, für die Idee von einem »Volk ohne Raum« …
Hugenbergs größter Coup war es, die Filmproduktionsfirma Ufa unter seine Kontrolle zu bringen, mit ihren Filmen, Kinos und Wochenschauen. Willi Münzenberg schrieb in »Film und Volk« über Hugenbergs Imperium: »Ganz zu Unrecht und zum Nachteil für die revolutionäre Propaganda verwendet man bedeutend mehr Energie auf die Bekämpfung der bürgerlichen Presse als auf die Bekämpfung des bürgerlichen Filmes. Dabei ist Hugenbergs Filmtätigkeit hundertmal gefährlicher als seine Zeitungen, allein schon durch die Tatsache, dass die Hugenberg-Zeitungen von Arbeitern wenig gelesen werden, während die nationalistischen und konterrevolutionären Filme aus dem Hugenbergischen Giftlaboratorium von Millionen Arbeitern angeschaut werden.« Die KPD-Zeitung »Rote Fahne« fragte: »Wozu soll denn die NSDAP offizielle Parteifilme drehen? Die Ufa besorgt die Filmpropaganda für den Faschismus viel besser und raffinierter, als es die Dilettanten könnten.«
Von rechts überholt
Für die DNVP lief es ab 1928 nicht mehr so gut: Alle Propaganda nutzte eher der NSDAP, deren Populismus brutaler und rücksichtsloser war. Nach einem Tiefschlag bei den Wahlen 1928 spaltete sich die Partei und Hugenberg kam aus der Deckung: Als neuer DNVP-Chef warf der Mann mit dem mächtigen weißen Schnäuzer sich erstmals selbst in die Rolle des Messias. Heute wird es selten erinnert, aber deutsche Nationalisten hatten damals die Wahl zwischen mehreren konkurrierenden Erlösern. Wenn etwa im Oktober 1929 drei Mann im Münchner Zirkus Krone auftaten, Hitler, Tirpitz, Hugenberg, und wenn dann die Scherl-Zeitung »Der Tag« über »die Rede des Führers« schrieb – war Hugenberg gemeint. Ebenfalls im »Tag« las man 1930 einen gemeinsamen Weihnachtsgruß von Hugenberg und Mussolini.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Hugenberg entfaltete dabei nie die Massenwirkung eines Hitler, neben dem »Gefreiten« aus dem Nichts war er doch eine wilhelminisch anmutende Figur, die auch viel durchschaubarer zu den alten Mächten gehörte als zu irgendeinem revolutionären Aufbruch. Selbst in Hugenbergs Blättern liefen immer mehr Journalisten zur braunen Konkurrenz über. Der Pressechef der DNVP schrieb 1931 an Hugenberg: »In den Scherlblättern geht die Propaganda für die Nationalsozialisten meiner Ansicht nach über das nötige Maß hinaus. Der Bericht von Kriegk über den bevorstehenden Wahlkampf in Oldenburg ist ein Beweis dafür. Er spricht nur von den Nazis, während er uns nur so nebenbei erwähnt. Hitler ist genannt, aber dass Sie dort gesprochen haben, ist nicht erwähnt.«
So waren Hitlers Wahlerfolge auch eine Konsequenz aus Hugenbergs Wirken, die radikale Weiterentwicklung von dessen Nationalismus, Antisemitismus und Herrenwahn. Hugenberg wurde schließlich Wirtschaftsminister im ersten Kabinett Hitler – und drei Tage nach der »Machtergreifung« gingen Hitler und Hugenberg zusammen ins Kino: Es gab »Morgenrot«, einen U-Boot-Film, der im Ersten Weltkrieg spielte, produziert natürlich von Hugenbergs Ufa.
Buchtipp: Klaus Wernecke, Peter Heller: »Medienmacht und Demokratie in der Weimarer Republik. Das Beispiel des Medienzaren und vergessenen Führers Alfred Hugenberg. Völlig überarbeitete Neuauflage, Brandes & Apsel 2023, 236 S., 29,90 €
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.