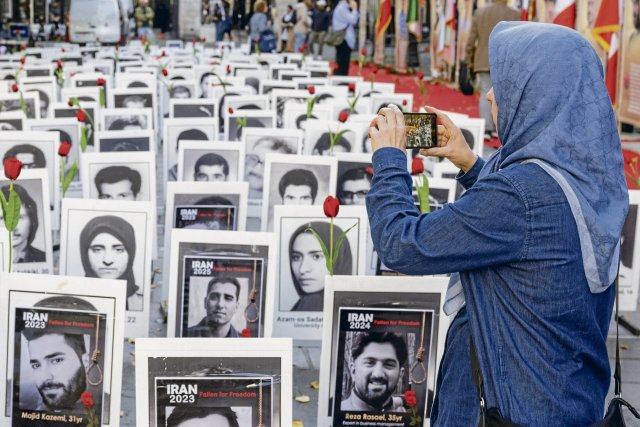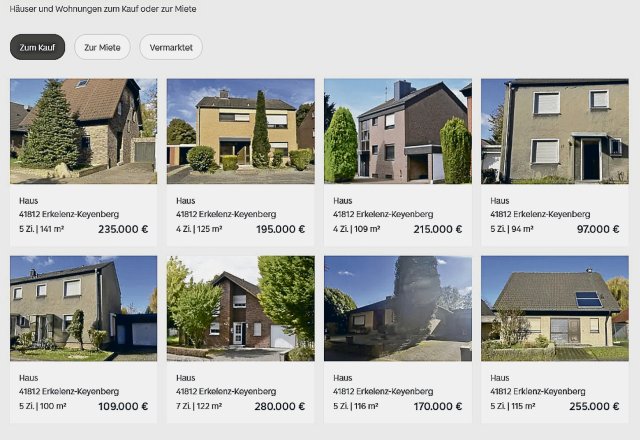- Politik
- Trump-Regierung
Der politische Umsturz in den USA
Donald Trump will die Zukunft im Interesse der digitalen Oligarchen den demokratischen Interventionen entziehen

Wir beobachten einen politischen Umsturz in den USA, der auf die Zerstörung des politischen Gemeinwesens in seiner gegenwärtigen institutionellen Form zielt. Zugleich beobachten wir eine ökonomische Weltmacht, die sich ihrem Niedergang mit einer Wendung zu einer neuformierten imperialen Politik entgegenzustemmen versucht. Beides trägt auf den ersten Blick höchst irrationale Züge, die gleichwohl einer eigenen Logik und Zielstrebigkeit folgen. Letztere ist keineswegs auf Rückschritt aus, vielmehr auf eine Zukunft, die im Interesse einer neuen herrschenden Klasse demokratischen, gesellschaftlichen Interventionen entzogen sein soll.
Was ist neu an der Politik von Donald Trump, im Vergleich mit der Politik von Thatcher und Reagan, der politischen Avantgarde des Neoliberalismus in den 80er Jahren? Sie betrieben die Privatisierung von Infrastruktur und den Kampf gegen Gewerkschaften und soziale Rechte innerhalb des institutionellen Rahmens der repräsentativen Demokratien ihrer Länder. Mit diesem Rahmen bricht die Politik der Trump-Regierung. Neu ist darüber hinaus der ökonomische und soziale Aufstieg der Oligopole des digitalen Kapitalismus mit ihren unterschiedlichen Aktionsfeldern und die ihnen von Trump übertragene unmittelbare politische Macht.
Die Angriffe im Inneren erfolgen offen, vor aller Augen, richten sich gegen staatliche Institutionen und werden mit Mitteln geführt, die sich über alle verfassungsgesetzten Grenzen hinwegsetzen. Trump setzt Rechte mit Dekreten außer Kraft, umgeht den Kongress und kujoniert dessen Mehrheit, bekämpft die Unabhängigkeit der Justiz. Die Regierung betreibt die Beseitigung von Behörden und Regeln, die – mit welchen Mängeln behaftet auch immer – die Wohlfahrt von Bürgerinnen und Bürgern betreffen, wie das Bildungsministerium, Behörden zum Schutz von Konsumenten, zum Schutz vor Krankheiten und zum Umweltschutz (in den USA sowie weltweit), die Finanzierung von Wohnungsgutscheinen, das Recht auf gerichtliche Verfahren bei der Entscheidung über Ausweisungen.
Andere Angriffe brechen den Schutzmantel staatlicher Institutionen im Umgang mit der Nutzung persönlicher Daten auf und eröffnen den Raubzügen privater Tech-Giganten Tür und Tor, wie im Fall der Invasion der Musk-Leute in die Steuer- und Finanzbehörden. Wieder andere Präsidialerlasse entziehen einem breiten Spektrum von Wissenschaften und wissenschaftlichen Institutionen die finanzielle Förderung.
Die Angriffe richten sich aber auch direkt gegen Personen und Personengruppen. Mit völkischem Furor und entwürdigender, kettenrasselnder Zurschaustellung werden Migrantinnen und Migranten ohne gültigen oder bei widerrufenem Aufenthaltsstatus gewaltsam aus dem Land getrieben, widerrechtlich eingesperrt. Per Dekret spricht Trump transgender Menschen die Existenz ab. In grotesker Verzerrung amerikanischer Geschichte werden weiße US-Amerikaner zu Opfern rassischer Diskriminierung erklärt; das befeuert den tief verwurzelten Rassismus gegen Afroamerikaner in der Gesellschaft.
Die Trump-Regierung beseitigt Behörden und Regeln, die – mit welchen Mängeln behaftet auch immer – die Wohlfahrt derBürger betreffen.
Zwei Hauptkräfte tragen den Umsturz: der libertär radikalisierte Neoliberalismus von Tech-Milliardären an der unternehmerischen Spitze der neuen digitalen Produktivkräfte und der Anti-Etatismus der US-amerikanischen völkischen Rechten mit einer sozialen Basis überwiegend in den ländlichen Gebieten, der Kern der Bewegung Make America Great Again (Maga).
Die Verbindung dieser beiden Kräfte in den USA hat eine weit vor Trump zurückgehende Vorgeschichte, die Quinn Slobodian in seinem noch vor Trumps zweiter Amtszeit geschriebenen Buch »Hayek’s Bastards. The Neoliberal Roots of the Populist Right« (»Hayeks Bastard. Die neoliberalen Wurzeln der Rechtspopulisten«) im Detail nachzeichnet. Dort findet sich der Hinweis auf eine strategische Neuorientierung der Protagonisten des libertären Neoliberalismus in den 90er Jahren: die Hinwendung zur weißen US-amerikanischen Arbeiterklasse, um eine gegen den Staat und die sie beherrschenden Eliten gerichtete Allianz zu bilden. Zur herrschenden Elite gehören demnach Politiker, Bürokraten, die alten Konzern- und Finanzeliten, die »neue Klasse der Intellektuellen und Technokraten«, einschließlich der Ivy-League-Universitäten.
In den 90er Jahren gelang es noch nicht, mit einer solchen Allianz Pat Buchanan ins Präsidentenamt zu bringen. Der Durchbruch erfolgte nach der Finanzmarkt- und Immobilienkrise sowie den sozialen Folgen der Covid-Pandemie mit den beiden Amtszeiten Trumps, insbesondere der gerade andauernden zweiten. Der löste nicht die Elitenherrschaft ab, die für die Finanz- und Immobilienkrise die Verantwortung trug, sondern stattete im Gegenteil die reichsten Kapitalisten des neuen digitalen Zeitalters und Verfechter eines libertär verschärften Neoliberalismus mit einer bislang ungekannten direkten politischen Macht aus.

Prof. Martin Kronauer ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der
sozialwissenschaftlichen Zeitschrift »Prokla«, die im Verlag Bertz + Fischer erscheint. Der hier veröffentlichte Text ist die gekürzte und leicht bearbeitete Fassung eines Beitrags aus der aktuellen »Prokla«-Ausgabe.
Zum Weiterlesen: www.prokla.de
In der Allianz zwischen der völkischen, elitekritischen Maga-Rechten und den marktradikalen Konzernchefs Elon Musk (Tesla, X), Peter Thiel (Paypal), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook) & Co. herrschen verbindende Kräfte: der politische Wille zur Zerstörung des Staats und zum Kampf gegen Gleichheit, insbesondere gegen jede Form politischer »Gleichmacherei«. Das ist der Kern der Angriffe auf Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Musk, der in Anlehnung an Argentiniens Präsident Milei die Kettensäge schwingt und die internationale völkische Rechte unterstützt, verkörpert geradezu die Einheit dieser beiden Momente.
Kapital ist aus Prinzip prinzipienlos. Die neue herrschende Klasse beruft sich, sofern sie sich überhaupt über die faktische Ausübung ihrer Macht hinaus glaubt rechtfertigen zu müssen, auf genetische Überlegenheit. Sie ist zugleich beseelt vom Glauben an die technische Beherrschbarkeit der Welt und die Steuerbarkeit von Gesellschaften, unter Ausschaltung der »Irrationalität« menschlichen, politischen Handelns.
In grotesker Verzerrung amerikanischer Geschichte werden weiße Amerikaner zu Opfern rassischer Diskriminierung erklärt.
Für die kapitalistischen Verfechter und Ausbeuter einer Welt, in der die Menschen auf Algorithmen zugeschnitten werden, sind demokratische Verfahren nur Hindernisse. Aus citizen mit ihren persönlichen, politischen und sozialen Rechten sollen Bürgerkonsumenten werden, die in marktorganisierten Enklaven ein Stimmrecht entsprechend ihrer Aktienanteile ausüben können. Solange allerdings staatliche Institutionen noch nicht radikal beseitigt werden können, gilt es, sie umzubauen und zu plündern. Das ist die Logik der Behörde Doge für »Regierungseffizienz«, die auch unter Musks zeitweiliger Führung vor allem dem Bürokratieabbau dienen sollte, und der von Trump betriebenen Günstlingswirtschaft bei der Besetzung von Regierungsposten.
An der Oberfläche der Rechtfertigung durch Trump liegen die internen Angriffe gegen den Staat und die externen gegen die Welthandelsordnung auf einer Ebene: es gelte, das Staats- und das Handelsdefizit zu beseitigen. Im Fall des Handelskriegs rückt aber noch ein weiteres Ziel ins Zentrum: Maga, sein Versprechen an die Wählerinnen und Wähler eines um die ökonomische Vormachtstellung in der Welt ringenden Landes, Amerika wieder groß zu machen. Im einen wie im anderen Fall sind die Angriffsmittel gewaltsam, grobschlächtig, willkürlich und mit verheerenden Nebenfolgen behaftet.
Trumps Angriffe auf die Welthandelsordnung sind mit einem grundlegenden Widerspruch behaftet: Sie wollen den US-Dollar als globale Leitwährung erhalten (deshalb die aggressive Reaktion gegen Vorstöße der Brics-Staaten, eine eigene Währungskoalition zu formen) und ihn zugleich abwerten, um das US-amerikanische Handelsdefizit zu beseitigen. Das Mittel seiner Wahl: Schutzzölle.
Ökonominnen und Ökonomen unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Denkschulen kritisieren Trumps Übertragung des Deal-Making aus seiner Welt des »Immobilienhais« (und mehrfachen Bankrotteurs) mittels erpresserischer Schutzzölle auf die Weltökonomie scharf, gelegentlich sarkastisch. Die brachiale Zollpolitik stößt auf Widerstand selbst bei Elon Musk, Tim Cook (Apple) & Co. Sie wollen Schutz vor chinesischer Hightech-Konkurrenz, operieren ansonsten aber weltweit und sind auf weltweite Lieferketten angewiesen.
Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass der Protektionismus bewirkt, was Trump seinen Wählerinnen und Wählern verspricht: Reindustrialisierung und geringe Inflation. Selbst wenn er zusätzliche ausländische Investoren in traditionelle Industriebranchen anziehen sollte, die damit die Zölle umgehen wollen, ist die Verlagerung von Produktionsstätten ein langwieriges Geschäft, wird die arbeitsteilige Kooperation mit Firmen im Ausland notwendig bleiben, werden die Produkte teurer. Die geplanten Steuererleichterungen werden das Staatsdefizit vergrößern. Und die Vorstellung, durch Zolleinnahmen die Einkommenssteuer ersetzen zu können, ist eine Schimäre.
Es mag sein, dass sich enttäuschte Wählerinnen und Wähler bei den Zwischenwahlen im Herbst 2026 von Trump wieder abwenden. Darauf scheint die demokratische Partei zu setzen, als Selbstläufer geradezu. Aber wohin werden sich die Enttäuschten wenden? Was hat die Demokratische Partei ihnen zu bieten? Das Besondere an der zweiten Trump-Wahl bestand ja gerade darin, dass sie in eine Zeit relativer ökonomischer Stabilität fiel, zu der die vorherige Biden-Regierung beigetragen hat (ganz im Unterschied zum Aufstieg faschistischer Parteien in Europa in den 20er und 30er Jahren). Ökonominnen und Ökonomen haben immer wieder auf die insgesamt positiven Wirtschaftsdaten hingewiesen. Dennoch hat eine, wenn auch schwache, Mehrheit denjenigen gewählt, der einen politischen Umsturz proklamierte (und nun auch durchführt). Ein Zurück zu politics as usual, selbst wenn es möglich wäre, wird nicht ausreichen, um die Unzufriedenheit in der tief gespaltenen US-amerikanischen Gesellschaft an ihren sozialen Wurzeln anzugehen.
Den Boden dafür haben auch Regierungen der Demokraten bereitet, insbesondere mit ihren Beiträgen zur weiteren Entfesselung der Finanzmärkte (Clinton) und der Schwäche ihrer Reaktion auf die Folgen der Finanzmarktkrise von 2008 (Obama). Ihre Basis unter den Verlierern der Globalisierung hat die demokratische Partei weitgehend eingebüßt. Politics as usual wird sie nicht zurückgewinnen. Ernsthafte Versuche, unter US-amerikanischen Wählerinnen und Wählern überhaupt wieder einen Boden für Widerstand gegen den politischen Umsturz zu bereiten, gehen deshalb vom Rand oder von außerhalb der Demokratischen Partei aus (Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez). Und ein bloßes Zurück könnte die Angriffe auf das politische Gemeinwesen nicht abwehren, die von den Protagonisten einer digitalen Zukunft ausgehen.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.