- Kultur
- Berliner Ensemble
Ein Wärter namens Hass
Das Berliner Ensemble eröffnet die neue Spielzeit mit Oscar Wildes »De Profundis« – und bereitet die Bühne für seinen neuen Schauspielstar Jens Harzer

Um mit dem Schluss, nämlich dem Schlussapplaus nach »De Profundis«, der Eröffnungspremiere zum Spielzeitauftakt am Berliner Ensemble, zu beginnen: Ein solch staunendes Klatschen des doch eigentlich beifallfaulen Hauptstadtauditoriums hat man an diesem Haus seit Jahren nicht erlebt. Es ist natürlich nicht die Sache des Kritikers, die Reaktionen des Publikums zu besprechen und zu interpretieren. Aber zu bestimmen, wem der Jubel gilt, braucht es keine besonderen, schon gar nicht hellseherischen Fähigkeiten: Hier wird ein Schauspielstar begrüßt, der seit dieser Spielzeit Teil des berühmten Ensembles am Bertolt-Brecht-Platz 1 ist. Ein Theaterstar, wie er in dieser Stadt noch fehlte und um den man Hamburg und München jahrelang beneiden musste.
Der Iffland-Ringträger Jens Harzer richtet sich in seiner neuen künstlerischen Heimat ein. Neben seinen gelegentlichen Ausflügen in Film und Fernsehen (»Babylon Berlin«) war er zuletzt am Hamburger Thalia-Theater beschäftigt und hat als Gast gelegentlich das Publikum in Wien und Bochum erfreut.
Und jetzt steht er alleine auf der Bühne des Berliner Ensembles. Ruft mit seiner unverkennbaren Stimme ins Publikum. Lässt seine Figur mit dem Text ringen, mit sich selbst, deklamiert stolz, stochert zweifelnd, singt traurig. Jede Handbewegung wirkt vollkommen natürlich in diesem artifiziellen Raum. Stiller Stolz, glühende Verachtung, Ungnade gegen sich selbst, all das weiß dieser Mann zu zeigen. Und für diesen ganzen Abend lässt Harzer einen nicht mehr los. Er verausgabt sich bis zur Erschöpfung. Und diesem Ausnahmespieler im Parkett gegenüber fühlt man sich selbst ebenfalls, in einem guten Sinne, erschöpft.
Diese Inszenierung lebt von und durch einen grandiosen Spieler. Wüsste Harzer nicht über knapp zwei Stunden ein Stück Literatur mit seinem ganzen Körper zu durchdringen, wenig bliebe übrig von diesem Abend.
Für »De Profundis« von Oscar Wilde, Klassiker der Weltliteratur und Schwulenikone, hat man sich bei der Spielplangestaltung am Berliner Ensemble entschieden. Keiner von den berühmten Texten des vor 125 Jahren verstorbenen irischen Schriftstellers, keiner, den er für die Bühne verfasst hätte oder der sich auch nur als szenische Grundlage sonderlich anböte. Es handelt sich um einen langen, 50 000 Wörter umfassenden Brief, den der wegen homosexueller Praktiken verurteilte Wilde im Zuchthaus verfasste, in dem er zwei Jahre zubringen musste.
Sein Adressat ist Lord Alfred Douglas, Wildes langjähriger Geliebter. Der Brief ist Anklageschrift und Bittgesang, Selbstkritik, Gefängnisschilderung, kunstphilosophische Abhandlung und große Litanei. Douglas, so erfahren wir, hat sich nicht bequemt, seinem Freund seine Aufwartungen im Gefängnis zu machen. Und Douglas trägt, lässt uns Wilde wissen, Mitschuld, vielleicht mehr als das, an der Lage des Inhaftierten. Hineingeraten in Fehde zwischen ihm und seinem Vater, wird Wilde und eben nicht Douglas von dem alten Mann denunziert. Hier steckt er nun, ein Mondäner, ein Dandy, ein Literat von Rang und ein homosexueller Mann, unter unwürdigsten Bedingungen eingekerkert.
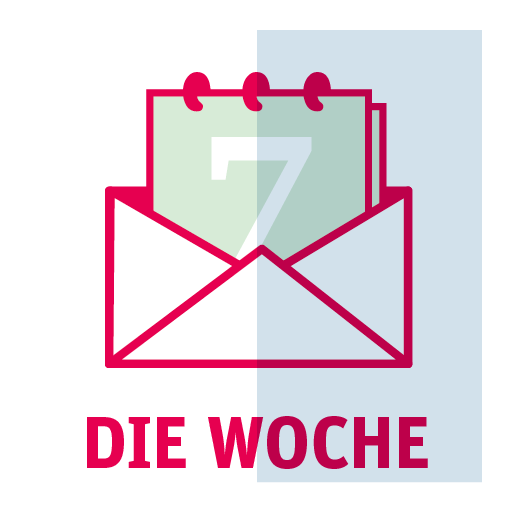
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Dieser Brief ist aller Sprachgewalt zum Trotz – »Die Eitelkeit hatte die Fenster vergittert, und der Name des Wärters lautete Hass«, heißt es da – aber doch mehr literaturhistorisches Zeugnis als Literatur. Dass Harzer diesen Text zu greifen weiß, das wäre bewiesen. Aber warum wurde er ihm vorgesetzt? Was erzählt er uns über die Gegenwart?
Zumindest Wildes darin enthaltene Überlegungen – das Leben als Kunst und die Kunst als eigentliche Realität – kann man nur als Schrulle aus dem vorletzten Jahrhundert betrachten. Von Genie ist immerzu die Rede, bemerkt man peinlich berührt. Und ganz haarscharf lässt sich nicht trennen, wo hier eine historisch gewordene Kunstauffassung endet und wo der Kitsch anfängt.
Die Regie (wie auch die Textbearbeitung) hat Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, besorgt. Er lässt das Licht auf den Star des Abends scheinen. Aber die Dringlichkeit der Inhalte dieses Briefes kann er uns inszenatorisch nicht vermitteln. Einige Entscheidungen, etwa die puppentheatergemäße Einrichtung der Bühne, die Ausstattung seines Solisten mit einem weißen Plastebeutel, fallen denkbar plump aus. Dass er aber seine Hauptfigur sich selbst den Kopf zermartern lässt, aber keine Bilder für die mit der Zuchthausstrafe einhergehende Folter durch unmenschliche Arbeit findet, ist ein ärgerliches Versäumnis.
Von diesem Theaterabend bleibt also vor allem die darstellerische Leistung eines Jens Harzer in Erinnerung. Die allerdings brennt sich ein. Wenn er erst mit den anderen Ensemblemitgliedern ins Spiel kommen darf und in Kollaboration mit anderen Regisseuren – Johan Simons! Frank Castorf! – sein Können zeigen wird, findet Berlin vielleicht bald wieder sein Theaterglück.
Nächste Vorstellungen: 18., 29.9. und 6.10.
www.berliner-ensemble.de
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







