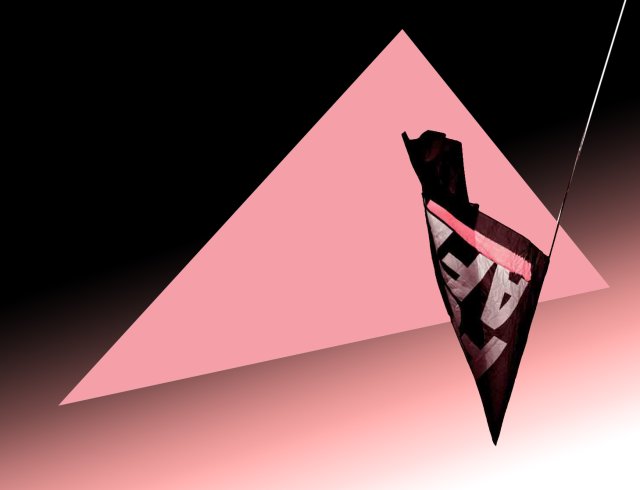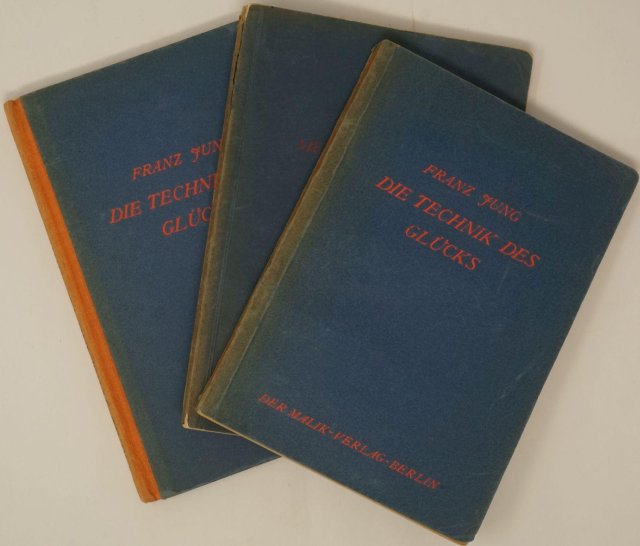- Kultur
- Fritz-Bauer-Preis
Gabriele Heinecke: Die Rechtsanwältin als Linksanwältin
Strafverteidigung ist ein Menschenrecht: Gabriele Heinecke wurde in Berlin mit dem Fritz-Bauer-Preis geehrt

Im Sommer 2009 war der frühere Offizier der 1. Gebirgsjägerdivision Josef Scheungraber aus Ottobrunn bei München vor dem Schwurgericht des Landgerichts München I wegen Mordes angeklagt. Ihm wurde zur Last gelegt, ein Massaker an den Einwohnerinnen in dem norditalienischen Dorf Falzano di Cortona am 26. Juni 1944 durchgeführt zu haben. Die Verhandlung unter Leitung von Richter Manfred Götzl plätscherte dahin. In der Befragung des Angeklagten machte dieser geltend, bei dem Massaker gar nicht dabei gewesen zu sein. Zum Tatzeitpunkt sei er ohne die ihm unterstellte Gebirgsjägereinheit damit beschäftigt gewesen, eine Brücke zu reparieren, weswegen er auch mit dem Massaker nichts zu tun gehabt haben könne.
Nachdem seitens des Gerichts und der Staatsanwaltschaft die Befragung abgeschlossen worden war, erhielt die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke das Wort. Sie vertrat die Interessen von 14 Nachkommen der Ermordeten aus Falzano di Cortona vor Gericht. Zuvor hatten sie bei Besuchen von ihr erfahren, dass bei Strafverfahren in der Bundesrepublik eine Nebenklage möglich ist. Heinecke stellte vor Gericht Fragen nach den Befehlsketten in der Gebirgsjägereinheit. Sie wollte wissen, wie Scheungraber als Offizier mit seinen Untergebenen konkret zusammengearbeitet hatte. Dadurch geriet auch Richter Götzl in Zugzwang. Nach den von Heinecke überhaupt erst eröffneten Sachzusammenhängen in dieser Strafsache sah er sich dazu veranlasst, den Angeklagten erneut zu befragen.
Heinecke wusste um die historisch völlig misslungene Strafverfolgung von Wehrmachtverbrechen vor bundesdeutschen Gerichten, weshalb sie sich dafür auch außerhalb des Gerichtssaales engagierte. Dank ihrem Auftreten wurde der ehemalige Wehrmachtsoffizier Scheungraber schließlich im August 2009 durch das Landgericht München wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Heinecke arbeitet seit mehr als 40 Jahren als Rechtsanwältin. Am vergangenen Samstag wurde ihr in Berlin von der Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union (HU) der Fritz-Bauer-Preis verliehen. Während der Preisverleihung im Haus der Demokratie und Menschenrechte wies Stefan Hügel, Bundesvorsitzender der HU, auf die vielfältigen Verdienste von Heinecke bei der rechtlichen Vertretung von Menschen hin, »die von Unrechtshandlungen oder Menschenrechtsverletzungen – begangen durch Staaten und deren Organe – betroffen und geschädigt wurden.«
Hügel hob den jahrelangen Einsatz von Heinecke im Strafverfahren Oury Jalloh gegen Dessauer Polizisten hervor, nachdem Oury Jalloh 2005 in der Zelle eines Polizeireviers verbrannt war. Auch ihre Mitwirkung bei der juristischen Aufarbeitung des NS-Massakers von Distomo vom 10. Juni 1944 in Griechenland, bei dem 218 Bewohner umgebracht worden waren, und beim Verfahren gegen die Täter des Massakers von Sant’Anna di Stazzema durch Männer der Waffen-SS am 12. August 1944, dem über 500 Menschen zum Opfer gefallen waren.
Sie übernahm auch die Strafverteidigung für Safwan Eid, der nach dem Brandanschlag auf ein Lübecker Asylbewerberheim als dort lebender Bewohner des zehnfachen Mordes beschuldigt wurde, während die Spuren ins rechtsradikale Milieu die Ermittler nur wenig interessierten. Nach einem dreijährigen Prozess wurde Eid freigesprochen. In diesem Strafverfahren und in dem gegen die Dessauer Polizei im Fall Oury Jalloh sorgte Heinecke, gestützt auf eigene Recherchen, für die Bestellung von Brandschutzgutachtern. Und diese stellten den von Gerichten und den Staatsanwaltschaften zuvor öffentlichkeitswirksam behaupteten Geschehensablauf fundamental infrage.
Der Strafrechtswissenschaftler Jörg Arnold stellte in seiner Laudatio mit dem von ihm positiv interpretierten Begriff einer »Linksanwältin« Heinecke in eine Reihe mit den Rechtsanwälten Heinrich Hannover und Christian Ströbele, die ebenfalls von der Humanistischen Union mit dem Fritz-Bauer-Preis ausgezeichnet worden waren. Arnold beschrieb eine Reihe von Stationen aus dem politischen wie beruflichen Lebensweg von Heinecke, die seit 1981 als Rechtsanwältin tätig ist, und würdigte dabei ihre Beteiligung an politischen Aktionen, beispielsweise der Besetzung der Hamburger Ausländerbehörde beziehungsweise des Foyers der Hamburger Bürgerschaft mit dem Ziel, gegen Ausweisungsbeschlüsse von Migranten zu protestieren. Manchmal muss der politische Protest nachdrücklich sein, auch wenn es einem selbst Strafverfahren einbringt.
Die Preisverleihung sei, so Arnold, auch als eine Würdigung von Heineckes Kampf »gegen die Gefährdungen der Strafverteidigung und für ein Selbst- und Fremdverständnis der Strafverteidigung als ein Menschenrecht« zu verstehen. Er konstatierte derzeit »angesichts des Weltzustandes im Großen wie im Kleinen« Momente von »Hoffnungslosigkeit und Pessimismus«, denen Heinecke jedoch mit ihrem ebenso gelassenen wie unermüdlich kämpferischen Einsatz widerstehe und dabei Mut und Hoffnung ausstrahle.
In ihrer Dankesrede berichtete Heinecke über die Mühseligkeiten in der juristischen Aufklärung von Staatsverbrechen in Fällen wie Distomo, Sant’Anna di Stazzema und Oury Jalloh. Am Beispiel der von ihr auch als »Krimi« bezeichneten juristischen Aufarbeitung des Massakers in Distomo und des dazu bislang erfolglos geführten Kampfs für Reparationszahlungen durch Deutschland erklärte sie: »Die deutsche Erinnerungskultur feiert sich selbst als vorbildlich. In Wahrheit dient sie vor allem der Eigeninszenierung. Es geht nicht darum, den Opfern des Faschismus gerecht zu werden. Der Fall Distomo zeigt das in aller Deutlichkeit. Gespräche mit Überlebenden über Entschädigung werden verweigert. Auch öffentlich wird wahrheitswidrig behauptet, es sei doch längst gezahlt worden. Dabei haben die meisten Opfer der Kriegsverbrechen nie eine Entschädigung erhalten. Stattdessen übt Deutschland politischen Druck aus und verklagt die einst überfallenen Staaten, weil deren Justiz Deutschland zu Entschädigungszahlungen verurteilt hat.«
Den jahrelangen Kampf für die Entschädigung dokumentierte eine Ausstellung des AK Distomo, die bei der Preisverleihung zu sehen war.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.