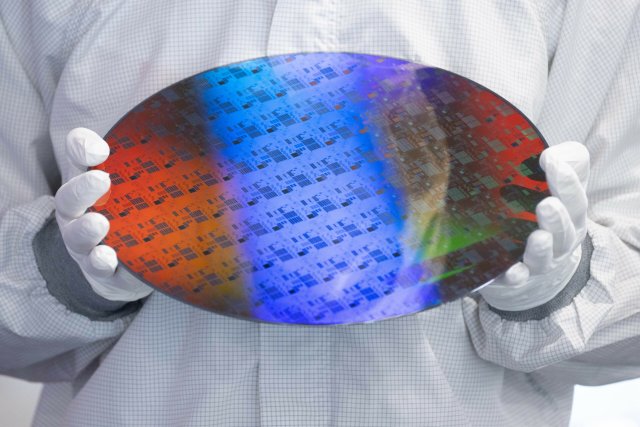- Wirtschaft und Umwelt
- Internationale Automobil-Ausstellung
Chinas Autos für den globalen Süden
In München beginnt die Leitmesse der Autoindustrie IAA. Chinesische Konzerne sind prominent vertreten

»It’s All About Mobility« – Alles dreht sich um Mobilität. So lautet das Motto der 71. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München. Seit Dienstag treffen sich Autohersteller und Autoliebhaber vor den futuristischen Ausstellungsflächen in der Innenstadt und in den Messehallen in München-Ried, um zu erfahren, wie der Weg vom Verbrenner hin zu einer nachhaltigen, vernetzten E-Mobilität zurückgelegt werden könnte. Mehr als 700 Aussteller aus 40 Ländern sind vertreten. Begleitet wird die Messe von protestierenden Umweltaktivisten. Besonders prominent vertreten sind Chinas Automobilkonzerne mit mehr als 100 Firmen.
Dass die deutschen Autokonzerne und ihre Zulieferindustrie bei der Elektromobilität hinterherfahren, daran werde auch die IAA in der bayerischen Landeshauptstadt nichts ändern, unkt der Wirtschaftsinfodienst »Business Insider«. Anders als in China, wo Hersteller wie BYD, Great Wall oder Xpeng ihre E‑Auto-Wertschöpfungskette von der Batterie über die Software bis hin zur Produktion aus einem Guss beherrschen.
Dabei tun sich Chinas Autokonzerne in der Europäischen Union bislang schwer. Im Jahr 2024 lag der Marktanteil chinesischer E-Autos nach Stückzahlen, trotz günstiger Einstiegspreise für Käufer, gerade mal bei rund zehn Prozent. Obwohl der Elektroanteil am gesamten Automarkt nach wie vor sehr klein und eher ein Nischenmarkt ist. Autos mit Benzin- oder Dieselmotor, sogenannte Verbrenner, verkaufen Chinas Hersteller in Europa nur in minimalen Stückzahlen.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Vor allem im globalen Süden hat Chinas Expansion dagegen an Fahrt aufgenommen. Die größte Anzahl an Autos, rund 300 000 Stück, gingen im ersten Halbjahr nach Mexiko. Auf den weiteren Rängen folgen die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland und Brasilien. In kleineren Automärkten wie Chile, Peru, Ägypten oder Kasachstan liegen die Marktanteile laut Medienberichten bei über 30 Prozent.
Dabei setzen Chinas Hersteller auf Produktion vor Ort, von Thailand über Ungarn bis Brasilien. Etwa 90 chinesische Autofabriken im Ausland sind in Bau oder fertiggestellt, weitere in Planung. Der massenhafte Ausbau der Fertigungskapazitäten im Ausland ist Teil einer Strategie der Konzerne sowie der Regierung in Peking, die auf günstige Produktion, lokale Fertigung und auf den jeweiligen Markt gezielte Modellpolitik setzt.
Chinas lange erfolgreiche Auto-Strategie stößt nun auf eine neue Problemlage: die Involution.
In China selbst entstanden in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Fabriken. Doch inzwischen wächst der Markt nicht mehr so schnell wie früher. 40 Prozent der chinesischen Haushalte besitzen nach Angaben des Beratungsunternehmens Automobility in Shanghai heute einen Pkw. Damit stößt die Nachfrage aus dem kaufkräftigen Mittelstand an natürliche Grenzen: Wer sich ein Auto leisten kann, besitzt eins. Zudem sind wohl in keinem Land E-Autos so populär wie in China. Mehr als die Hälfte der Neuwagen ist elektrifiziert. Verbrenner werden da schnell zum Ladenhüter. Als Ventil dient den Unternehmen die Ausfuhr.
Chinas lange erfolgreiche Auto-Strategie stößt nun zudem auf eine neue Problemlage: die Involution. »Der Begriff ist mittlerweile fest im chinesischen Sprachgebrauch verankert«, schreiben die Analysten des in China aktiven US-Finanzdienstleisters T. Rowe Price. Er beschreibt einen Teufelskreis, in dem Unternehmen immer mehr Aufwand für immer geringere Erträge pro Auto betreiben – oft, indem sie Preise senken und Kapazitäten ausweiten, um noch nennenswerte Gewinne einfahren zu können.
Von Solarmodulen über Stahl und Logistik bis zu Elektrofahrzeugen hat die Involution (lat.: »Windung«) viele Branchen mit hauchdünnen Margen in der Volksrepublik erzeugt. Um zu überleben, um auf diesen »tendenziellen Fall der Profitrate« (Karl Marx) zu reagieren, müssen Chinas Autohersteller im Ausland im Wortsinne um jeden Preis expandieren.
Als Reaktion darauf hat Peking eine umfassende »Anti-Involution-Kampagne« gestartet, um auf Überkapazitäten und Preisverfall zu reagieren. So greifen Regulierungsbehörden in die Preisgestaltung im Markt für Elektrofahrzeuge ein, um den ruinösen, preisgetriebenen Wettbewerb zu bremsen. Gleichzeitig dient die Exportförderung dazu, den hart umkämpften heimischen Markt zu entlasten. So schwappt der Preiskampf aus China in ferne Länder über. Dort aber entstehen gerade neue Fabriken chinesischer Autohersteller oder sie produzieren bereits Abertausende Neuwagen im Monat. Ein weiterer Teufelskreis droht. Zurück in München endet die Internationale Automobil-Ausstellung diesen Freitag.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.