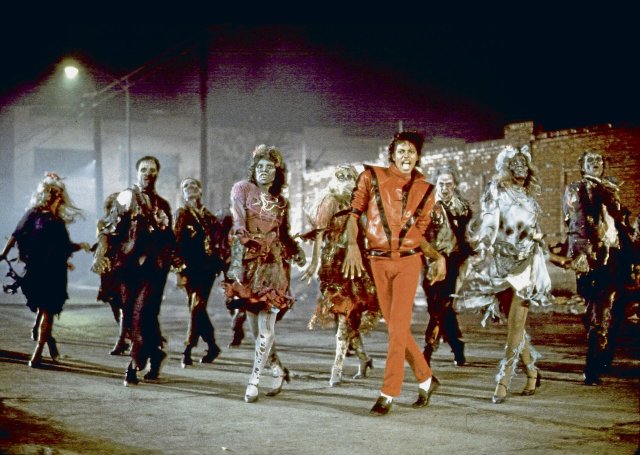- Kultur
- Jens-Fietje Dwars
Utopist im rückwärtigen Dienst
Sehr schön zwanghaft lehrt Jens-Fietje Dwars uns: »Erfolg ist ein Irrtum«
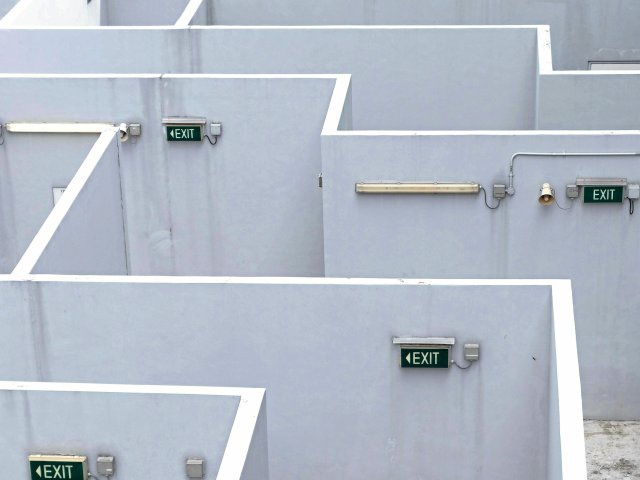
Kaum etwas ist schwerer zu erkennen als die Richtung jener Prozesse, deren Teil und Zeuge man ist. Diese Tatsache verweist auf spannende Phänomene der Unvereinbarkeit – von Leben und Erkenntnis: Wir sind Auffassungstoren, da und dort einen goldenen Zierrat erwischend, ihn fast immer verfehlend, und dennoch tun wir, als ob wir – Wissende seien. Aber kitten lässt er sich nicht, jener Widerspruch zwischen der Unberechenbarkeit unserer Existenz und dem Bemühen um eine möglichst logische Geschichts- wie Zeitschreibung.
Woher kommt dieses Mühen? Ganz einfach: Jedes Leben braucht Protektion. Wir wollen gerechtfertigt sein. Der schwelgende Romantiker beansprucht so viel Geltung wie der lederne Zyniker. Und erfährt diese Arbeit dann eine öffentliche Anerkennung, tritt ernüchternde Wahrheit auf den Plan: »Erfolg ist ein Irrtum.«
So heißt das Buch von Jens-Fietje Dwars – Reden, Essays, Kommentare aus über drei Jahrzehnten. Der Verleger und Autor, der Kurator und Herausgeber schreibt aus Jena ins Land hinein (hinaus?), seit jeher so leidenschaftlich wie leidend, denn: Wer ohne Lobby wirken will, würgt stets auch an den geschäftsführenden Ignoranzen des Literaturbetriebs.
Dwars’ Ausdauerwerk über die Jahre hin: sorgsam edierte Bücher und Reihen. Schöne Zwanghaftigkeit auch in eigenen Texten: Er möchte Anstoß sein, deshalb der unbändige Ausstoß an Papier, und deshalb auch der fortwährende Vorstoß mit Geist. Was naturgemäß vor Köpfe stößt. Denn dieser Autor will scharf bleiben in der Analyse von Zeitenfluss und Zeitenschlamm; und wo er in schwebende Stimmung gerät, verliert er sich niemals im schwärmend Ungefähren.
Im vorliegenden Band legt er herz- und kopfhorchende Aufsätze vor. Aufblättert sich in über 30 Texten der Roman eines philosophischen Denkens wider die Plapperei der gelösten Zungen – diesem Zeitzeichen epidemischer Unterhaltsamkeit. Gibt es ein »Halteseil der Vernunft durch die Labyrinthe allgegenwärtigen Wahns«? Das ist die Dwars-Frage, wach gehalten in Essays für Leute, die sich angesprochen fühlen, wenn man ihnen, zum Beispiel, mit Nietzsche käme. Der schrieb: »Übrigens ist mir alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit … unmittelbar zu beleben.«
Dieser Autor will scharf bleiben in der Analyse von Zeitenfluss und Zeitenschlamm
Nietzsche: Ausdauernd, anregend wird er von Dwars bemüht, etwa die Geburt der modernen Künste aus dem Geist dieses Philosophen. Und anderer. Wie gelangt man, ganz ohne Ausflucht in höhere Mächte, zur Selbst-Schöpfung? »Vielleicht müssen wir doch noch einmal durch den Feuerbach hindurch.« Und dann der Ort Jena – den erzählt Dwars über einen besonderen »Staffelstab des Denkens«: die großenteils unbekannten Kantianer Schütz und Schmid, Häupter in der »Alchemistenküche« Thüringens, wo einst die Anregendsten ihrer Zeit nach Weisheit gesucht hatten. Auch Schiller und Novalis treten auf – Lehrer in der »Grundschule einer Freiheit, die man später Revolution nennen wird«. Die war – deutsche Erfahrung – kein Irrtum, also auch kein Erfolg.
Betrachtungen zu Christoph Hein, Erik Neutsch, Christa Wolf, Kurzportäts von bildenden Künstlern wie Horst Hussel, Strawalde, Moritz Götze, und manchmal nur das Kleinod eines Satzes: »Gibt es Gott, wenn die Ordnung das Chaos schafft?« Dwars beschreibt, was ihn an ein geistiges Erbe bindet, und er führt so auch den Leser fort. Dorthin, wo man leben darf in Berührung mit einem eindringlichen Ton, also dem Sirren der Sirenen. Du liest das wie unter einem Regen, der dich reinwäscht vom falschen Wichtigkeitsgefühl, vom Zeitungsgeist, vom Klebstoff Tages-Ordnung. Du vernimmst Töne eines Utopisten im rückwärtigen Dienst. Nicht restaurative geschichtliche Beschwörung ist das, sondern Aufruf dessen, was wir als fordernden, reichen Haushalt der Gestimmtheit und der Erinnerungswürde in uns tragen. Lohnender Auftrag: lieber behutsam altgierig sein als nur immer forsch neugierig.
Er blickt auf den Baseler Kongress 1912, also aufs Versagen der Sozialdemokratie vor den dunklen Horizonten des kommenden Weltkrieges. Er porträtiert Peter Weiss, dessen »Ästhetik des Widerstandes« ist ihm der »grausamste, kälteste und zugleich mitfühlendste Text der deutschen Literaturgeschichte«. Er denkt nach über »zweckrationale Mechanismen der Machtreproduktion«, die mit Stalin kein Ende hatten. Immer der Blick auf Strukturen. Geschichte stets auch als Vor-Geschichte (so was kommt von so was) und als flirrender Prozess. Ein Bedenken ist das, gesetzt wider die geläufige Dämonisierung weltpolitischer Diktatoren. »Wozu bräuchte man eine Geschichtswissenschaft, wenn sie lediglich die Irrationalität historischer Prozesse bestätigt, ein Urteil das der der Alltagsverstand billiger zur Hand hat«.
Der Autor arbeitet gleichsam, im unentwegten Wechsel, mit Fernrohr und Mikroskop. Heißestes Bemühen mit kaltem Blick, auch auf sich gerichtet. Zu den aufregendsten Essays gehört »Das Leben der anderen Anderen«: ein Brief über Dwars’ eigenes Schicksal zwischen DDR und Westen; ein wahrhaftig nachgezeichnetes Labyrinth aus Courage und Vorsicht, aus Träumen und Taktik, aus wissenschaftlicher Leidenschaft und politischen Konsequenzen. Ein Text, gestrickt aus Überzeugung (»ich war Trotzkist, ohne Trotzki gelesen zu haben«) und Verstrickung, das Fluchwort heißt »Stasi«, und Sätze haken sich fest: »Mich zog die eitle Neugier eines Beziehungslosen in den Bann des Bösen.« Was bleibt, nach 1990? »Unsägliche Trauer um die Vergeblichkeit aller Mühen, sich verständlich zu machen.«
Der Mensch, der sich erinnert, ist in diesen Betrachtungen ein Versucher – der zwischen Werden und Vergehen keinen schmiegsamen Standpunkt finden will. Der aber doch jenes Bindende erschauen möchte, das dem Dasein in wechselnder Zeit eine verlässliche Grundbestimmtheit gibt. Trotz fortgesetzter Brüche. Der Autor ist hellsichtig, ohne zu triumphieren; er steht aufrecht in störrischem Eigensinn: Im Herbeirufen zeitgenössischer Geistgrößen aus ganz anderer Zeit wird ihm die Gegenwart zum »Paradies von Teufeln, die ihren Eigennutz hinter der Fassade des Gemeinnutzen pflegen«.
Der Ton ist mitunter gezielt scharf, schroff. Etwa gegen »Stotterer der Geschichtsschreibung«, die in Jahrestagen denken, nicht in Problemen, also Wieder- und Übergängen. »Schwarzbücher rechnen mit dem Kommunismus ab, als hätte es ihn je gegeben, und die Erben der Geschichte üben sich in permanenter Entschuldigung.« So etwa beschäftigt Dwars jener Widerspruch von Goethe und Buchenwald – »Klassik und Konzentrationslager«, das berüchtigte Pendant von Weimar, »längst zum Werbeslogan verkommen, zum heimlich unheimlichen Standortvorteil im Tourismusgeschäft«.
Er geht durch die Gedenkstätte von Buchenwald. Monumental, mythisch. Was aufrütteln möge – es erschlägt auch. Er liest die Zeilen von Johannes R. Becher, gewidmet Ernst Thälmann, eingemeißelt in die Stelen. Religion und Verklärung, ein Einzelner wird aus ideologischem Vernutzungsdrang »zum wundersamen Sinngeber namenloser Leiden«. Und der erschreckende Gedanke steigt auf: Die tausendfachen Opfer der faschistischen Gewalt würden so noch einmal erniedrigt, »sie verkommen zur grauen Masse einer versteinerten Erinnerung«.
Was hilft einem, der im verhallenden Wort lebt? Das Geschriebene? Nein. Es hilft nur: schreiben. »Werden Bücher nicht gelesen, möchte man verstummen vor Schmerz und sollte dennoch weiterreden, immer genauer, konzentrierter, bis an die Grenze zum Schweigen.« Denn: Erfolg mag ein Irrtum sein, das strebende Weiterschreiben nicht.
Jens-Fietje Dwars: Erfolg ist ein Irrtum. Reden, Essays und andere Randbemerkungen. Edition Ornament im Quartus-Verlag, geb., 272 S., 22 €
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.