- Politik
- Brasilien
Agrarkonzerne außer Kontrolle: Der Druck auf Arbeiter ist immens
Drei Saftkonzerne haben in Brasilien den Markt weitgehend unter sich aufgeteilt. Ein Arbeitsrechtler warnt vor neuen marktliberalen Reformen

Rafael de Araújo Gomes ist Staatsanwalt für Arbeitsrecht. Erst Anfang August hat er sein neues Büro im 11. Stock eines Bürogebäudes in Araraquara bezogen – gleich gegenüber von einem der größten Arbeitgeber der Stadt mit 250.000 Einwohnern. Das Logo des Saft-Unternehmens Cutrale prangt nicht nur auf dem stattlichen Schornstein, der die Saftfabrik schon von weitem ins Auge springen lässt, sondern auch an der riesigen Werkhalle. Unzählige Rohrleitungen verlaufen über das weitläufige Areal des Konzerns, der Orangensaft nach Europa und in den Rest der Welt liefert.
»Cutrale ist einer von den drei brasilianischen Saft-Konzernen, die gemeinsam den brasilianischen Markt weitgehend kontrollieren. Die anderen beiden heißen Citrosurco und Louis-Dreyfus-Juice-Company und liefern das Saftkonzentrat überwiegend nach Europa, wo dafür spezialisierte Terminals in den Häfen von Antwerpen und Gent existieren«, erklärt Sandra Dusch, Orangensaftexpertin der Christlichen Initiative Romero aus Münster. Sie ist heute gemeinsam mit zwei Journalisten bei Rafael de Araújo Gomes zu Besuch, um sich über die jüngsten Rückschläge bei der Implementierung der Arbeitsrechte zu informieren.
Cutrale sei ein Konzern, der sich nicht scheut, miese Praktiken anzuwenden, berichtet Gomes: »Ein Beispiel: Ich habe die Rechte schwangerer Frauen gegenüber Cutrale verteidigt und das Unternehmen angeklagt.« Das Urteil ist gesprochen, nur über die Höhe der Entschädigungszahlungen werde noch gefeilscht, so der Staatsanwalt. »Ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass die Rechtsabteilung von Cutrake genau kalkuliert, was mit Verstößen gegen das Arbeitsrecht zu verdienen ist. Es wird aus einer rein ökonomisch durchkalkulierten Perspektive agiert«, erläutert Gomes seine Einblicke.
Das ist kein Einzelfall in Brasilien. Dort sind große Agrarunternehmen in den letzten Jahren unter den konservativen Regierungen von Michel Temer und Jair Bolsonaro immer einflussreicher geworden, was mit zahlreichen Rückschritten bei den Arbeitsrechten einherging. »Brasilien hat eigentlich eine gute Arbeitsrechtsgesetzgebung. Alle internationalen Abkommen und Konventionen sind ratifiziert worden, aber wir haben immense Rückschritte bei der Kontrolle zu verzeichnen«, erklärt der Staatsanwalt.
Er arbeitet eng mit den Inspektionsteams aus dem Arbeitsministerium zusammen. Die sind allerdings chronisch unterbesetzt und waren unter der Regierung von Jair Bolsonaro quasi kaltgestellt: Es gab keine Etats für deren Arbeit. Das hat sich mit dem Amtsantritt des amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva im Januar 2023 zwar geändert. Zudem hat er rund 800 neue Inspektoren in den Arbeitsministerien einstellen lassen. Das sind positive Signale für mehr Kontrollen, doch Spezialisten wie Jorge Ferreira dos Santos, Koordinator der Gewerkschaftsorganisation Adere MG, monieren, dass parallel rund 1000 Inspektoren beiderlei Geschlechts in den Ruhestand gingen. Das bestätigt auch Rafael de Araújo Gomes, dessen Vater als Inspektor im Arbeitsministerium arbeitete.
»Unser Kontrollsystem ist geschwächt. Wir haben zu wenig Inspektionen und auch in die technische Ausstattung der Teams ist zu wenig investiert worden. Sie brauchen mehr Expertise«, erklärt Gomes, der zudem ein Stadt-Land-Gefälle kritisiert. Während in reichen Bundesstaaten wie Sāo Paulo die Zahl der Fälle von Arbeit unter sklavenähnlichen Bedingungen rückläufig sind, wofür die Mechanisierung mitverantwortlich sei, ist das im benachbarten Bundesstaat Minas Gerais anders. Dort wird viel Kaffee angebaut und noch per Hand gepflückt. Fälle von sklavenähnlichen Ausbeutungsverhältnissen bei der Kaffeeernte seien dort häufiger als bei der Orangenernte im Bundesstaat Sāo Paulo.
»In den letzten 12 Monaten gab es zwei, drei Fälle, in denen Arbeiter aus sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen im Bundesstaat Sāo Paulo herausgeholt wurden – im Nachbarstaat Minas Gerais waren es 24«, so Gomes. Die Zahlen werden jedes Jahr im April vom Arbeitsministerium veröffentlicht und die verantwortlichen Unternehmen auf einer »Schmutzigen Liste« öffentlich gemacht. Die Liste, auf denen die Unternehmen zwei Jahre aufgeführt werden, ist ein probates Instrument, um gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen in der Exportlandwirtschaft, vor allem im Orangen-, Obst- und Kaffeeanbau, aufmerksam zu machen.
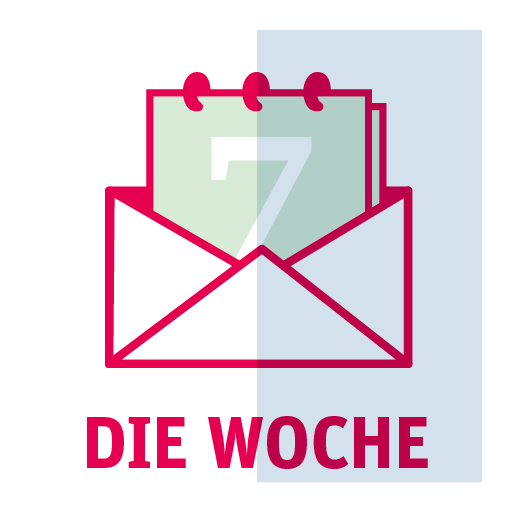
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Allerdings moniert die Arbeitsrechtsdozentin Livia Miraglia von der Universität Minas Gerias, dass die Justiz die Verantwortlichen zu sanft anfasse. In Brasilien werde die massive Ausbeutung von Pflückerinnen und Pflücker oft wie ein Kavaliersdelikt geahndet, statt wie ein ernstes Verbrechen, kritisiert Miraglia. Dabei sind die Gesetze eindeutig. Wenn Unterkünfte menschenunwürdig sind, wenn Schuldknechtschaft durch das Berechnen von Wucherpreisen für Unterkunft, Transport und Lebensmittel vorliegt, wenn die gesetzlich fixierten Arbeitszeiten deutlich überschritten und Beschäftigte auf Farmen gegen ihren Willen festgehalten werden, liegen dem brasilianischen Arbeitsgesetz zufolge sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse vor. Dagegen kämpfen spezialisierte Staatsanwälte wie Rafael de Araújo Gomes. Für Sandra Dusch und ihre christliche Initiative Romero ist Gomes ein idealer Kontakt, um die Informationen zur brasilianischen Saftindustrie auf den aktuellen Stand zu bringen.
Die Zahl der spezialisierten Staatsanwälte ist jedoch zu gering, die Infrastruktur hinter ihnen zu schwach, kritisiert die Landarbeitergewerkschaft Contar. Dass die Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva diese Strukturen in absehbarer Zeit ausbauen kann, ist jedoch wenig wahrscheinlich. Aus dem Unternehmerlager häufen sich derzeit die Initiativen, Arbeiter und Angestellte dazu zu drängen, sich als Solo-Selbständige registrieren zu lassen. »Bei der Müllabfuhr gibt es erste Beispiele«, berichtet Staatsanwalt Gomes. Er warnt, dass derartige Gesetzesinitiativen Schule machen könnten, wie die für Uber-Fahrer, die derzeit in den Parlamentsausschüssen hängt. Eine weitere sieht vor, dass quasi jede Tätigkeit als Soloselbständiger ausgeführt werden könne.
Für Gomes untergraben derartige Initiativen die Arbeitsgesetzgebung, aber auch das System der Sozial- und Rentenversicherung. »Uns droht ein sozialer Rollback von immenser Tragweite«, warnt er. Gerade jüngeren Arbeiternehmern sei das nicht bewusst. Großen Unternehmen wie Cutrale sehr wohl. Cutrale würde zu den ersten Unternehmen gehören, das neue Arbeitsverträge für Soloselbständige einführen wird, prognostiziert Gomes mit bitterer Mine.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







