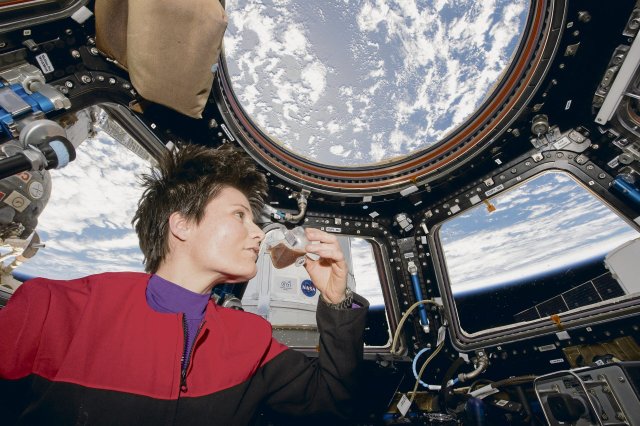- Wissen
- Ostsee
Bedrohtes Multitalent
Unterwasserwälder aus Blasentang bilden wertvolle Lebensräume und entziehen der Atmosphäre große Mengen Kohlendioxid

Am Nordwestzipfel der großen dänischen Insel Fünen scheint die Welt noch in Ordnung: Die grünbraunen Blätter des Blasentangs (Fucus vesiculosus) wiegen sich im Wellengang. Am Meeresboden leuchten lila-, blassrosa- und ockerfarbene Seesterne, Krabben suchen nach Wasserschnecken, und weiter draußen, in der Mitte der Meerenge, schwimmt eine Gruppe Schweinswale.
Blasentangwälder gehören wie Seegraswiesen zu den typischen Ökosystemen der Ostsee. Sie beherbergen bis zu 500 Arten, von Einzellern bis hin zu Fischen, die darauf laichen oder sich darin verstecken. Die Algen versorgen sie mit Sauerstoff und reinigen das Wasser. Auch leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, wie eine bereits Ende 2022 erschienene Studie Bremer Wissenschaftler*innen zeigt: Algen geben bis zu ein Drittel des aufgenommenen Kohlenstoffs in Form zuckriger Verbindungen wieder ins Umgebungswasser ab. Nur sehr wenige spezialisierte Bakterien seien in der Lage, den vom Blasentang ausgeschiedenen Mehrfachzucker Fucoidan zu zerlegen. »Je komplexer ein Zucker aufgebaut ist, desto langsamer wird er mikrobiell zersetzt, oder er bleibt sogar langfristig erhalten«, erklärt Inga Hellige, die an der Studie mitgearbeitet hat und inzwischen als Postdoktorantin an der Universität Göteborg tätig ist. So bliebe der Kohlenstoff über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende gebunden.
An der Südküste Fünens bietet sich ein ganz anderes Bild als im Nordwesten der Insel: An den kleinen Stränden türmen sich dicke Polster angeschwemmter, bereits getrockneter Fadenalgen. Großflächige Braunalgenteppiche treiben vor der Küste. Auch im äußersten Südwesten tragen die Wellen Algen an Land, es stinkt nach faulen Eiern – ein Geruch, der bei deren Zersetzung entsteht.
Blasentangwälder beherbergen bis zu 500 Arten, von Einzellern bis hin zu Fischen.
Tatsächlich herrscht seit Ende August im Südfünischen Inselmeer und südlichem Kleinen Belt wie im Aabenraa Fjord, Schlei, Flensburger Förde, Fehmarn Belt und Aarhuser Bucht starker Sauerstoffmangel. Dies belegt ein kürzlich erschienener Bericht des Dänischen Zentrums für Umwelt und Energie (DCE) der Universität Aarhus. Im Innern des Haderslev Fjords wurden Ende Juli tote Fische gefunden. Obwohl der Sauerstoffgehalt dänischer Gewässer schon die letzten zwei Jahre Rekordtiefs erreichte, hat sich die Situation weiter verschlimmert. »Die betroffene Fläche war (im Juli und August 2025) um ein Fünftel größer als 2024 und 3,5-mal so groß wie 2023«, resümiert Christian Fromberg von Greenpeace Dänemark. Dabei wird normalerweise erst im September der Peak erreicht. »Wenn sich die Sauerstoffarmut wie erwartet fortsetzt, wird dies schwerwiegende Folgen haben, vor allem für das Leben am Meeresboden in den am stärksten betroffenen Gebieten«, warnen die Autor*innen des Reports.
Schuld daran ist die hohe Nährstoffzufuhr aus der Landwirtschaft. »Diese führt zu einem explosiven Wachstum von Plankton und opportunistischen Fadenalgen im Sommer«, so Fromberg. Bei ihrer Zersetzung verbrauchen Mikroben große Mengen Sauerstoff. Bei den Fadenalgen handelt es sich, laut Per Andersen vom Institut für Ökowissenschaften an der Universität Aarhus, um die Braunalgen Pylaiella littoralis und Ectocarpus penicillatus sowie einige Grün- und Rotalgenarten. »Diese braunen Fadenalgen wachsen wie Fucus spp. (die Familie zu der der Blasentang zählt, Anm. d. A.) auf harten Oberflächen, wie Felsen oder Steinen, und als Aufsitzerpflanzen auf Seegras und Blasentang«, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin für Meeresschutz am Umweltbundesamt, Stephanie Helber. »Wenn sie sich durch hohe Nährstoffeinträge vermehren, überwuchern sie Seegras und Blasentang regelrecht.«
Doch die große Braunalge sei »ziemlich robust«, versichert der Kieler Meeresökologe Martin Wahl. Während die Fadenalgen einjährig sind und so im Spätsommer absterben, könnte sich der mehrjährige Blasentang trotz wenig Licht bei niedrigen Temperaturen im Winter wieder erholen. Zum Problem könnten die Fadenalgen lokal dennoch werden, wenn sie in sehr großen Mengen vorkommen, warnt die Meeresexpertin vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Dorothea Seeger. In großen Stürmen werden sie von ihrem Hartsubstrat gerissen und treiben frei im Meer umher. Ein Teil von ihnen wird von den Wellen ans Ufer geschmissen, ein anderer verrottet im Wasser und kann dadurch den ohnehin knappen Sauerstoff am Meeresgrund verbrauchen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Seit den 1960er Jahren ist der Blasentang in der Ostsee massiv zurückgegangen. »Früher kam er bis in eine Tiefe von acht bis zehn Meter vor, weil das Wasser klarer war«, erzählt Wahl. Heute findet man ihn in weiten Teilen der Ostsee nur noch in den ersten drei Metern. Auch die steigenden Wassertemperaturen machen ihm zu schaffen.
Damit er sich wieder ausbreiten kann, braucht es strenge Auflagen für die Landwirtschaft, wie sie Schweden bereits in den 1960er Jahren beschlossen und umgesetzt hat. Eine diesjährige Studie schwedischer Wissenschaftler*innen unter der Leitung von Ellen Schagerström zeigt, dass sich die Blasentangbestände nördlich von Stockholm wieder erholt haben.
In Dänemark sind die Nährstoffeinträge trotz diverser Regierungsmaßnahmen in den letzten 40 Jahren immer noch zu hoch. Ein neuer Plan mit dem Namen »tripart« nimmt vor allem die Tierhaltung ins Visier, tritt aber erst ab 2027 in Kraft. In Deutschland hat sich die Lage laut UBA seit 1990 gebessert, doch auch hier ist noch viel Luft nach oben.
Im noch laufenden Forschungsprojekt »CliPA« untersuchen Wissenschaftler*innen der Universitäten Kiel und Rostock und des Geomar, ob sich Blasentang an Offshore-Windanlagen kultivieren lässt. Dafür haben sie direkt unter der Wasseroberfläche Seile gespannt. Die Alge soll Nährstoffe aus dem Wasser filtern und Kohlenstoff binden. Sie kann ganzjährig geerntet und als Nudelersatz, für Salben und in Biogasanlagen energetisch genutzt werden. Die Gärreste stellten ihrerseits eine kostengünstige und umweltschonende Alternative zum Kunstdünger dar. Noch ungelöst sei das Problem eines Massenbefalls mit Miesmuschel-Larven, berichtet Wahl, der in dem Projekt mitarbeitet. »Allerdings zeigen jüngste Ergebnisse, dass junge Algen sehr lange unter der Muschelbedeckung überleben und nach deren Verschwinden anscheinend weiterwachsen können.«
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.