- Kultur
- Sexismus im Pop
»Candy Girls« von Snja Eismann: Reine Würstchenparty
Sonja Eismanns »Candy Girls« entlarvt Sexismus in der Musikindustrie

In der sehenswerten Miniserie »Daisy Jones & the Six« (Disney+), die sich locker an die konfliktreiche Bandgeschichte von Fleetwood Mac anlehnt, lässt sich die selbstbewusste und talentierte Keyboarderin Karen auf ein Verhältnis mit dem Gitarristen der Band ein. Der will ihre Beziehung gern öffentlich machen, sie sträubt sich. Sie sei zu gut und habe zu hart gearbeitet, erklärt sie ihm, um in der Öffentlichkeit nur noch als Gespielin des Gitarristen wahrgenommen zu werden.
Die Serie spielt in den frühen 70ern. Wer glaubt, das Pop-Business hätte im Laufe der Dekaden seinen pawlowschen Sexismus abgelegt wie eine allmählich speckig gewordene Fransenlederjacke, muss Sonja Eismanns »Candy Girls« lesen. Ihr instruktiver, mit verständlichem Zorn geschriebener Essay präpariert systematisch die emanzipatorischen Defizite des Musikgeschäfts in der Geschichte, aber eben auch in der Gegenwart heraus und unterfüttert den Befund mit einer enormen Menge an Belegen. Die Beweislast ist er- und auch einigermaßen bedrückend.
Das in Songtexten von Iggy Pop, New Edition oder 50 Cent zur Etikettierung des weiblichen Personals aufgerufene »Candy« erklärt Eismann zur Chiffre für offenbar immer noch nicht obsolete männliche Wunschfantasien. »Candy Girls haben keine eigene Handlungsmacht. Sie sind dafür da, besungen, beglotzt, fetischisiert, exotisiert, aufgerissen und verschlungen zu werden. Sie sollen köstlich sein, nicht bitter, denn dann werden sie beschimpft oder gleich komplett entsorgt.«
Eismann weiß sehr wohl, dass in Zeiten von Beyoncé, Billie Eilish und Taylor Swift genügend Gegenbeispiele von durchsetzungsstarken, erfolgreichen, also sehr wohl handlungsmächtigen Frauen den Blick verstellen können für einen weiterhin manifesten strukturellen Sexismus. Sie diagnostiziert ihn in den von Männern profilierten, ausgebeuteten und generationell wiederkehrenden Lolita-Figuren, in denen antibürgerlicher Tabubruch und Pädokriminalität eine ekelhafte Liaison eingehen. Wer noch einmal die einschlägigen Skandale nachlesen will, etwa die jüngst ruchbar gewordenen Abscheulichkeiten von John Peel oder Steve Albini, kann das hier tun.
Die Autorin analysiert den »Male Gaze« und zeigt die Zwänge des unter Dauerbeobachtung stehenden weiblichen Körpers, der nie den Anforderungen der Öffentlichkeit genügen kann und der vor allem nicht altern darf. Sogar feministische Ikonen wie Kim Gordon oder Madonna ziehen irgendwann die kosmetische Chirurgie zurate, weil die ältere Frau im Pop keine Rolle spielt – oder es zu wenig Rollen für sie zu besetzen gibt.
Darüber hinaus zeichnet Eismann die maskuline Abwertung der weiblichen Fankultur nach und widmet sich ausführlich dem ambivalenten Groupie-Phänomen, das erstaunlich unscharf zwischen Aktivismus und Missbrauch changiert. Zum einen nämlich nimmt sich die historische Groupie-Kultur einen sexuellen Hedonismus heraus, den Männer längst für sich beanspruchen, zum anderen degradieren Musiker ihre weiblichen Fans eben auch regelmäßig zu sexuell dienstbaren Musen.
Man bekommt in »Candy Girls« einen ziemlich guten Überblick über die popfeministischen Debatten und lernt darüber hinaus einiges über traditionell gewachsene, nicht mehr hinterfragte Alltags-Misogynie, deren Absurdität einen immer wieder den Kopf schütteln lässt. So gehört es anscheinend bis heute zu den ungeschriebenen Gesetzen von Radio-Redaktionen, keine zwei von Frauen gesungenen Songs hintereinander zu spielen, weil das den Hörer überfordern könnte.
Nicht immer plausibel sind ihre Interpretationen von Songtexten. Wenn sie grundsätzlich auf Mehrdeutigkeit angelegte, mit literarischen Strategien operierenden Lyrics einer ideologischen Prüfung unterzieht und diese auf eine allzu eindeutige Lesart reduziert, fordert das schon mal Widerspruch heraus. Vor allem weil dabei einiges unter die Räder kommt, was Kunst dürfen muss.
Bruce Springsteen und noch dazu sein Song »I’m On Fire« könnte mir egaler gar nicht sein, aber aus den darin vorkommenden Andeutungen (»Hey, little girl, is your daddy home?/ Did he go away and leave you all alone?/ I got a bad desire/ Oh, oh, oh, I’m on fire«) eine pädophile Neigung des lyrischen Ichs zu konstruieren, geht vielleicht doch zu weit. Wer sagt denn, dass hier ein erwachsenes Ich spricht? Könnte hier nicht auch ein männlicher Teenager, sagen wir 19, seine erotischen Fantasien formulieren? Und nehmen wir mal das Schlimmste an: Hier träumt also wirklich ein 33-jähriger Typ, wie Springsteen 1982 bei der Aufnahme des Songs einer ist, von Sex mit einem Mädchen – vielleicht war das ja sogar die Absicht Springsteens, so ein leichtes Unwohlsein zu erzeugen angesichts dieser schmierigen Obsession? Was weiß ich schon?
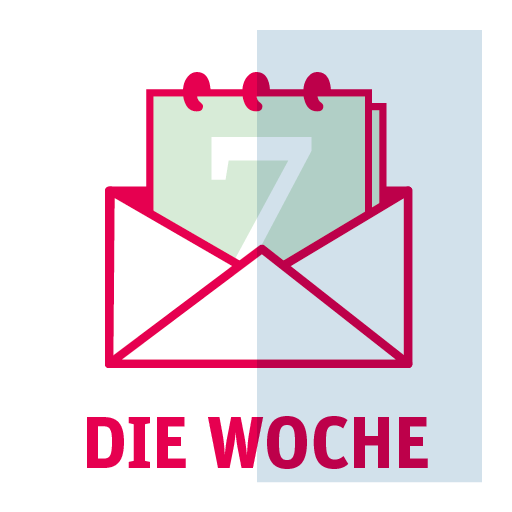
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Dass der Widerspruchsgeist geweckt wird, liegt aber vielleicht auch an dem geballten Vorwurfs-Bombardement, das ja auch immer einem selbst gilt. Vor allem wenn Eismann den Sexismus der Pop-Berichterstattung analysiert, komme ich als Schreiber zumindest mittelbar selber vor. Wer die unbemerkten sexistischen Kalkablagerungen im eigenen Denken und Schreiben loswerden oder sie doch zumindest minimieren will, muss da einfach durch.
Zweifel am strukturellen Sexismus in der Musikindustrie darf sowieso keiner haben, das zeigen allein die blanken Zahlen, die Eismann hier aufbietet. Die Beteiligung von Bands mit zumindest einer Frau in ihren Reihen auf den großen Festivals bleibt auch in den letzten Jahren konstant bei etwa 10 Prozent, meistens noch darunter, und das, obwohl diese Misere allgemein bekannt ist. »Reine Würstchenparty«, lästerte der Bayerische Rundfunk zu Recht. Und so geht das fort und fort. Von 949 Mitgliedern der amerikanischen Rock & Roll Hall of Fame sind 91,6 Prozent männlich wie auch 85 Pozent der Gema-Mitglieder. Die Musik in deutschen Charts wird zu mehr als 85 Prozent von Männern komponiert, unter den Lehrenden an den Musikhochschulen sind nur 17 Prozent Frauen usw.
Das liegt wohl auch an den fehlenden Role Models, deshalb beendet Sonja Eismann ihr Buch mit einer ersten Skizze eines feministischen, antipatriarchalen »Flinta-Pop-Kanons« und setzt suggestive Blitzlichter auf Willie Mae »Big Mama« Thornton, Gertrude »Ma« Rainey, Lesley Gore, Nina Simone, die Ronettes, Carole King, Helen Reddy und einige andere Frauen, die Lust machen, sich mit ihnen näher zu beschäftigen. Mit Sister Rosetta Tharpe zum Beispiel, der »Godmother of Rock ʼnʼ Roll«, die schon früh mit angezerrten Gitarrensounds gespielt und auf ihrer gemeinsamen England-Tour mit Muddy Waters die jungen Blueser Jeff Beck, Keith Richards und Eric Clapton ziemlich beeindruckt hat. Mich jetzt auch.
Sonja Eismann: Candy Girls. Sexismus in der Musikindustrie. Edition Nautilus, 196 S., br., 20 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







