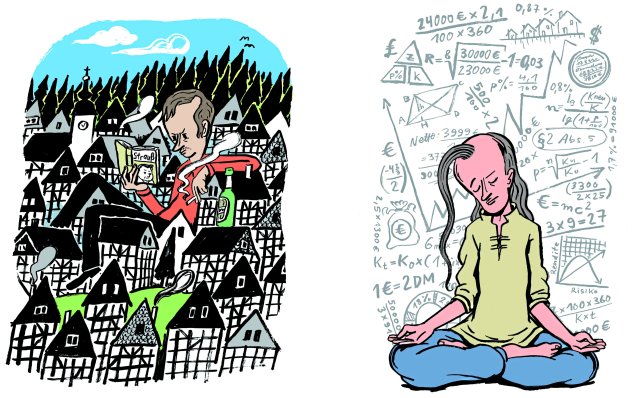- Kultur
- Ersan Mondtag
Jeder Bahnhof ist ein Zuhause
Ersan Mondtag inszeniert am Gorki-Theater ein Stück über türkische Gastarbeiterinnen. Ein Gespräch.

Trifft man den Theaterregisseur Ersan Mondtag in seiner Wohnung, muss man dahin, wo sich der Ostteil Berlins vielleicht von seiner architektonisch schönsten Seite zeigt. Ziemlich weit oben, in einem signifikanten Bauwerk des sozialistischen Klassizismus, errichtet von Hermann Henselmann. Nicht allzu weit entfernt von Kreuzberg, das für ein ganz anderes Berlin steht und wo Mondtag aufgewachsen ist.
Um Berlin und seine Geschichte, um die Grenzen, um ihr Verschwinden und ihr erneutes Auftauchen geht es auch in Mondtags jüngster Inszenierung. »Das rote Haus« ist der Titel dieser Arbeit, die in der kommenden Woche Premiere feiert und die Spielzeit am Maxim-Gorki-Theater eröffnet. Das rote Haus – das bezeichnet jenen Ort in der Stresemannstraße 30, wo sich im vorvorletzten Jahrhundert ein Kadetteninternat befand. Hier lernte auch Bismarck Zucht und Ordnung – und gab das Gelernte gerne weiter an die deutsche Bevölkerung. Heute steht an dieser Stelle das Willy-Brandt-Haus, der Sitz der Bundeszentrale der SPD. Und in der Zwischenzeit? In den 60er Jahren errichtete der Technikkonzern Telefunken hier ein Wohnheim für Gastarbeiterinnen, die in jener Zeit vorrangig aus der Türkei angeworben wurden.
Der Geschichte dieser Gastarbeiterinnen nähert sich Mondtag an, nicht dokumentarisch, sondern künstlerisch verdichtet. Zu jenen Frauen zählt auch Emine Sevgi Özdamar – Schauspielerin, Schriftstellerin, Büchner-Preisträgerin. In ihrem Roman »Die Brücke vom Goldenen Horn«, dem zweiten Teil ihrer autobiografischen Istanbul-Berlin-Romantrilogie, widmet sie sich in einer märchenhaft schönen Sprache ihrer Zeit im Mehrbettzimmer, in einer fremden Stadt, in der vor allem ihre Arbeitskraft gefragt war.
Özdamars Roman entnimmt Mondtag einzelne Motive. Aus Interviews mit mehreren Frauen, die für Telefunken gearbeitet haben, hat er vier Figuren für sein Stück entwickelt. »Es geht auch darum, Berlin noch mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Mit diesen Geschichten fügen wir dieser Stadt noch mal einen Teil zu ihrer DNA hinzu«, beschreibt er das Vorhaben. Dennoch will er die Arbeit weder als Dokumentartheater noch als Empowerment-Theater verstanden wissen. Aber doch als Würdigung dieser Frauen und ihrer bisher kaum erzählten Geschichten.
»Ich bin gekommen, um das Brecht-Theater zu lernen«, lautet ein paradigmatischer Satz von Emine Sevgi Özdamar, den sie in den 70er Jahren dem prägenden Theaterregisseur Benno Besson an der Ostberliner Volksbühne entgegengebracht hat und den sie mehr als einmal in ihren literarischen Werken zitiert. Ersan Mondtag sagt lachend: »Ich komme eher vom Illusionstheater, also dem Gegenteil von Brecht.«
Mondtag hat sich zwar mit »Baal« und der »Dreigroschenoper« bereits an Werken Brechts probiert, seine Theaterkarriere sogar im Alter von 18 Jahren als Hospitant am Berliner Ensemble, der Brecht-Bühne also, begonnen. Aber was er dann als Regisseur, mitunter auch als Bühnen- und Kostümbilder auf die Szene bringt, sieht doch gänzlich anders aus.
Ersan Mondtag kann als der große Konstrukteur atmosphärischer Bilderwelten gelten.
-
Ein starkes Formbewusstsein prägt seine Arbeiten. In sich geschlossene Kunstwelten erschafft er auf der Bühne, hochartifiziell, grell, düster. Unter den Regisseuren im deutschsprachigen Theaterbetrieb kann Mondtag wohl als der große Konstrukteur atmosphärischer Bilderwelten gelten.
»Ich würde schon sagen, dass es für eine*n Künstler*in wichtig ist, eine Ästhetik zu entwickeln, bei der die*der Betrachter*in das Gesehene mit einem direkt in Verbindung bringt«, erklärt Mondtag seinen Anspruch. »Auch weil man sich nicht beliebig jedes Mal neu einer Sache hingibt, sondern weil man länger an einer Form arbeitet und sie weiter perfektioniert. Irgendwann nervt es dann vielleicht alle. Aber immerhin hat man eine Form erschaffen, das muss man erst mal hinkriegen.«
»Ein Bahnhof ist ein Zuhause.« So heißt es an irgendeiner Stelle in »Seltsame Sterne starren zur Erde«, dem letzten Teil von Emine Sevgi Özdamars Istanbul-Berlin-Romantrilogie. Es ist ein programmatischer Satz für diese Schriftstellerin, die das Grenzgängertum zu ihrem Lebensprinzip gemacht hat.
Auch deswegen wirkt es keineswegs abwegig, wenn Mondtag zu »Das rote Haus« ausführt: »Das Bühnenbild ist eine Art verlassener Bahnhof, es könnte aber auch ein Fabrikgelände sein, eine Fabrikhalle, könnte auch eine Turnhalle sein, könnte auch ein Ballsaal sein. Wir haben aus unterschiedlichen Sälen einen Hybridraum gebaut mit ganz vielen Türen. Dort entstehen schemenhafte Fragmente von diesem Wohnheim.«
Nicht nur räumlich verlegt Mondtag die Handlung in eine Art Zwischenwelt, auch zeitlich springt er von Bismarck in die 1960er Jahre, zum Mauerfall und in die nahe Zukunft, in der das rote Haus zum Remigrationszentrum wird. Nein, kein Happy End. Angesichts des Erfolgstaumels der AfD und dem weltweiten Aufstieg faschistischer Kräfte sieht Mondtag kaum Raum für Hoffnung.
Damit fügt sich die Inszenierung gut in den Spielplan des Gorki-Theaters unter der scheidenden Intendantin Shermin Langhoff. In den vergangenen zwölf Jahren hat sie unter dem Schlagwort postmigrantisches Theater die Bühne genutzt, um die vielen Geschichten der anderen, der Ausgestoßenen, Geflohenen, Übersehenen zu erzählen. Oft kämpferisch. Nicht in jedem Fall künstlerisch überzeugend. Aber doch stilprägend und mit großer Wirkung auf das Theater im gesamten deutschsprachigen Raum.
»Ich hatte immer Schwierigkeiten mit dem Begriff postmigrantisch«, gibt Mondtag zu verstehen, »weil ich gar nicht genau verstanden habe, was das bedeuten soll, wo das Postmigrantische anfängt und wo es aufhört. Aber ich glaube, es hat trotzdem Sinn gemacht, dass man das Label genutzt hat, um auch eine Aufmerksamkeit für bestimmte Defizite zu erzeugen. Und es hat auch tatsächlich viel verändert. Ich würde sagen, seit Frank Castorf hat niemand das Theater so stark geprägt wie Shermin Langhoff. Castorf hat das Theater ästhetisch erneuert und Langhoff hat es gesellschaftlich erneuert. Das wird so in die Geschichte eingehen. Deswegen finde ich auch, dass die Mission des postmigrantischen Theaters beendet ist.«
Mondtag entschuldigt sich für seine heisere Stimme. Gleich mehrfach binnen einer Woche habe er im Flugzeug gesessen und sich wohl an der Klimaanlage verkühlt. Er ist gut beschäftigt. Nach der Premiere in Berlin eröffne er eine Ausstellung in Istanbul, dann unterrichte er Schauspielstudenten in Rom, darauf folge eine Uraufführung am Münchner Residenztheater, eine Opernproduktion in Wiesbaden und, zum Abschluss der Spielzeit, eine Arbeit an der Wiener Staatsoper.
Der Theaterkünstler gilt als mitunter schwierig in der Zusammenarbeit. Er sei autoritär, heißt es. Eine Zuschreibung, die im Theater, das seit Jahren über Macht und Hierarchien streitet, nicht unbedingt gut ankommt. Er selbst hat das eine oder andere Mal in Interviews beredt Auskunft darüber gegeben, wenn es wieder lauter geworden ist oder wenn Möbel geflogen sind. Heute klingt das aus Mondtags Mund alles etwas gemäßigter. »Mit Schauspieler*innen habe ich eher selten Probleme, weil ich die ja auch selber aussuche. Ich möchte dann ja mit diesen Personen arbeiten. Das ist dann eher eine Beziehung, die man freiwillig eingeht. Aber im Theater gibt es ja trotzdem 300 weitere Mitarbeiter*innen, von denen man dann nicht mit jeder*m unbedingt freiwillig und gerne arbeitet, sondern es ist dann, was es ist. Und wie in jeder anderen Beziehung gibt es da manchmal Konflikte.«
An Selbstbewusstsein jedenfalls mangelt es Mondtag nicht. Im Gespräch aber strahlt er eine freundliche Gelassenheit aus. Und man will ihm glauben, wenn er sagt: »Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen ganz großen Konflikt mit einer*m Schauspieler*in hatte. Das muss schon länger her sein.«
Ersan Mondtag kennt natürlich die Debatten, die an den Theatern geführt werden. Aber er fühlt sich, so macht es den Eindruck, zunächst den eigenen künstlerischen Überzeugungen verpflichtet. Eines der Probleme sieht er an den Hochschulen, die für die Theaterarbeit ausbilden.
»Die Schulen sind wirklich No-go-areas für Künstler*innen mittlerweile. Da muss man echt vorsichtig sein. Das ist ein Minenfeld, in dem sich all diese Diskurse ausbreiten. Bei Schauspielstudierenden merkt man schon, wenn es um bestimmte Frauen- oder Geschlechterbilder geht, dass es dann relativ schnell zu Widerstand kommt. Auf keinen Fall möchte man diese Dinge reproduzieren. Das hat sich total breit gemacht. Da stellt man sich die Frage: Wie wollen wir Probleme oder Konflikte verhandeln? Ich verstehe, wenn man bestimmte Dinge nicht reproduzieren will, aber dann kann man nur noch darüber sprechen und es bleibt nur noch eine sehr bestimmte Form des Theaters. Und ich glaube, das wäre langweilig.«
Nicht immer fällt die Unterscheidung ganz leicht. Hat man es nur mit künstlerisch ambitionierter Sozialarbeit zu tun? Handelt es sich um Kunst mit einem sozialpolitischen Anspruch? Bei Mondtag allerdings scheint die Sache doch klar: Da will jemand Geschichten erzählen, Bilder erschaffen. Alles andere ist bei ihm nachrangig. Und langweilig soll es bestimmt nicht sein.
Premiere: 2.10.
Weitere Vorstellungen: 3., 4. und 19.10.
www.gorki.de
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.