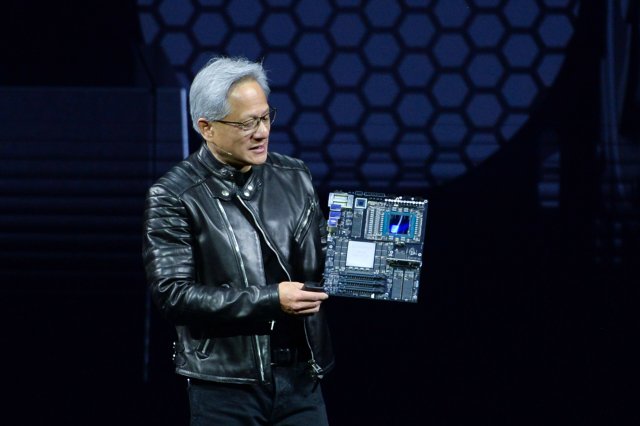- Wirtschaft und Umwelt
- Rezession
IMK-Report: Ungewöhnliche Konjunkturstütze
Erstmals seit Wende wird Wirtschaft durch Binnennachfrage getragen

»Die deutsche Konjunktur gleicht derzeit einem Flugzeug, das nur mit einem Motor fliegt«, fasste Sebastian Dullien, Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die wirtschaftliche Entwicklung zusammen. Am Donnerstag präsentierte er mit seinem Team die neue Konjunkturprognose. Demnach steht die deutsche Wirtschaft nach einer fast zweijährigen Rezessionsphase an einem Wendepunkt: Für die Jahre 2025 und 2026 wird wieder leichtes Wachstum erwartet.
Doch der Aufschwung ist historisch ungewöhnlich. Denn er wird nicht vom Export getragen, sondern vollständig von der Binnennachfrage. Diese kompensiert die Verluste im Außenhandel. »Erstmals seit der Wiedervereinigung sehen wir einen binnenwirtschaftlich getriebenen Aufschwung«, erklären die Expertinnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll im Jahresdurchschnitt zunächst um 0,2 Prozent und im folgenden Jahr um 1,4 Prozent steigen.
Zwei Säulen: Reallöhne und öffentliche Investitionen
Das binnenwirtschaftliche Wachstum basiert auf zwei Säulen: Die privaten Konsumausgaben steigen zunächst um 1,2 Prozent und 2026 um 1,6 Prozent. Höhere Reallöhne sind die Hauptursache. »Zugleich ist die Inflation so weit zurückgegangen, dass aus den Lohnerhöhungen spürbare Kaufkraftgewinne resultieren«, heißt es im Report. Die Teuerungsrate soll 2025 bei 2,0 Prozent liegen und 2026 auf 1,8 Prozent sinken.
Ein entscheidender Faktor ist daneben die geplante Erhöhung der Ausgaben durch die Bundesregierung. Zwar wird dieser Impuls 2025 noch nicht stark spürbar sein, aber im folgenden Jahr soll er das Wirtschaftswachstum mit 1,1 Prozent des BIP deutlich beeinflussen.
Treiber sind insbesondere das neue Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sowie steigende Verteidigungsausgaben. Die sollen auch eine Trendwende bei den Ausrüstungsinvestitionen einleiten, die 2026 um 5,8 Prozent zunehmen. Besonders im Fahrzeugbau und im Rüstungsbereich wird sich das bemerkbar machen, erklärte Konjunkturexperte Christian Breuer auf nd-Nachfrage.
Außenhandel verhindert stärkeres Wachstum
Ein Wirtschaftsboom ist zeitnah indes nicht zu erwarten. Die größte Herausforderung bleibt der Außenhandel. »Derzeit überlagern sich Trends. Exportorientierte Unternehmen werden weiterhin Probleme haben«, sagt Dullien. Gründe sind der Wettbewerbsdruck aus China und die Zollpolitik der US-Regierung.
Die Handelsvereinbarung zwischen der EU und den USA löst die Unsicherheit nicht auf. Die Zölle in Höhe von 15 Prozent belasten die Unternehmen weiter. Und die Regierung unter Präsident Trump droht mit neuen Strafzöllen, sollte die EU ihre Gesetze zu digitalen Märkten nicht zurücknehmen. Zudem werden bei Stahl- und Aluminiumprodukten immer mehr Artikel mit Aufschlägen belastet.
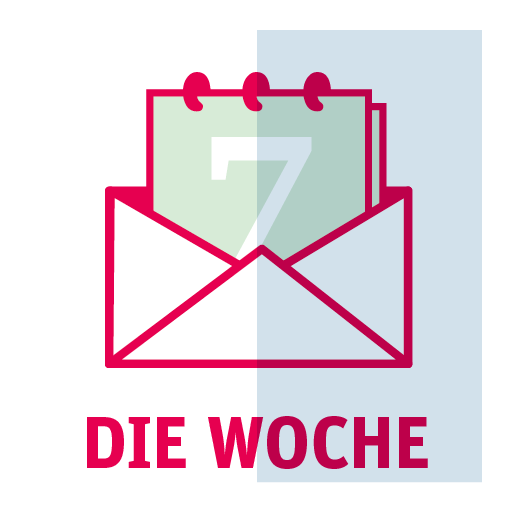
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Exporte sollen 2025 um 1,2 Prozent sinken und 2026 nur leicht um 0,7 Prozent wachsen. Gleichzeitig werden die Importe aufgrund der steigenden Inlandsnachfrage zunehmen (2,8 Prozent 2025 und 3,6 Prozent 2026). Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss, also das Verhältnis von Exporten zu Importen, wird voraussichtlich auf 2,8 Prozent des BIP sinken. Das ist der niedrigste Wert seit 2003.
Mit Blick auf den außereuropäischen Handel trägt dazu auch der zuletzt starke Euro im Vergleich zum Dollar bei. Die IMK-Expert*innen kritisieren, dass die Europäische Zentralbank es versäumt habe, »die Zinsen angesichts der starken Aufwertung des Euro und der massiven Zollerhöhungen erneut zu senken«.
Prognose mit Risiken
Eine große Unbekannte ist zudem, ob und wie schnell die schwarz-rote Koalition die versprochenen Investitionen tätigt. »Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der expansiven Finanzpolitik sind schwer abschätzbar«, heißt es auch in der Gemeinschaftsanalyse der fünf führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland, darunter das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Ifo-Institut.
Hinzu kommt, dass die Ausgaben nur teilweise durch Steuereinnahmen gedeckt sind. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant, Kredite in Höhe von knapp 90 Milliarden Euro aufzunehmen. Ab 2027 entstehe dadurch ein erheblicher Konsolidierungsbedarf, heißt es in der Gemeinschaftsanalyse, die ebenfalls am Donnerstag vorgestellt wurde.
Unionspolitiker fordern dafür Einschnitte bei den Sozialausgaben. Das könnte die Konsumstimmung stark belasten, warnt das IMK: »Zur Katastrophe kann es kommen, wenn wegen leichtsinniger Manöver des Piloten der zweite Motor auch noch ausfällt. Die von einigen geforderte Sozialstaatsdebatte sind genau solche leichtsinnigen Manöver zur Unzeit«, erklärt IMK-Direktor Dullien.
Gemeinschaftsdiagnose sieht strukturelle Probleme
Noch kritischer bewertet DIW-Konjunkturexpertin Geraldine Dany-Knedlik die Lage: »In den beiden kommenden Jahren erholt sich die deutsche Wirtschaft zwar spürbar. Angesichts anhaltender struktureller Schwächen wird diese Dynamik allerdings nicht von Dauer sein«, stellt sie fest.
Laut Gemeinschaftsdiagnose werden die strukturellen Probleme durch die staatlichen Investitionen nur kaschiert. »Grundlegende standortstärkende Reformen bleiben aus«, heißt es in der aktuellen Analyse. Das werde sich in voraussichtlich sinkenden Wachstumsraten des Produktionspotenzials widerspiegeln. »Hohe Energie- und Lohnstückkosten im internationalen Vergleich, Fachkräftemangel sowie eine weiter abnehmende Wettbewerbsfähigkeit bremsen die langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin«, so das Fazit.
Verwerfungen im Außenhandel und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit belasten derzeit insbesondere die exportorientierte Automobilindustrie sowie die vorgelagerten Zulieferbetriebe. So kündigte auch Autozulieferer Bosch am Donnerstag an, in der Mobility-Sparte Kosten sparen zu wollen. Dazu sollen bis 2030 an deutschen Standorten etwa 13 000 weitere Stellen abgebaut werden.
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise hatte die IG Metall Mitte September gemeinsam mit dem Verband der Automobilindustrie von der Regierung umfassende Unterstützungsmaßnahmen für die kriselnde Schlüsselbranche gefordert.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.