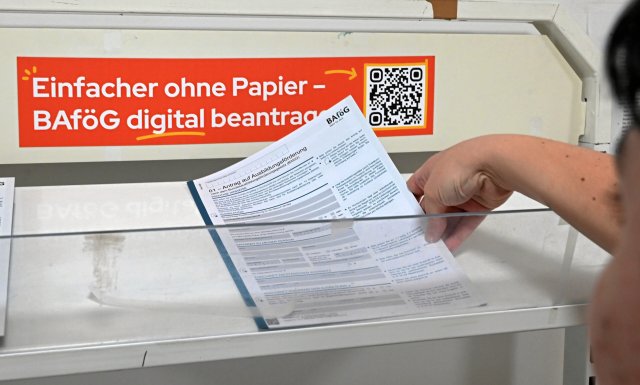- Politik
- Häusliche Gewalt
»Häusliche Gewalt ist kein privates Problem«
Annalena Schmidt zu physischen und psychischen Übergriffen im familiären Bereich und Voraussetzungen für ihre Eindämmung

In Nordrhein-Westfalen hat das Landeskriminalamt gerade neue Zahlen zu häuslicher Gewalt vorgelegt. Demnach stieg die Zahl der erfassten Fälle um zwei Prozent an. Wieso kommt es überhaupt zu häuslicher Gewalt?
Sie ist selten ein »Ausrutscher«. Meist geht es um Macht und Kontrolle – darum, eine andere Person kleinzuhalten. Gewalt ist dann ein bewusst eingesetztes Mittel. Häufig spielen eigene Gewalterfahrungen, erlernte Verhaltensmuster und gesellschaftliche Erwartungen eine Rolle. Traditionelle Vorstellungen von Stärke, Kontrolle und Männlichkeit können Gewalt begünstigen, aber auch Normen, die Rücksichtnahme oder Verletzlichkeit als Schwäche deuten. Sie erschweren es vielen Betroffenen, sich Hilfe zu holen. Häusliche Gewalt ist nicht nur individuelles Fehlverhalten, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Sie hat strukturelle Ursachen in patriarchalen Systemen, ökonomischen Abhängigkeiten und in Normen, die Gewalt verharmlosen oder legitimieren.
Wie erklären Sie sich diesen Zuwachs in NRW auf 67 000 Fälle, wobei die Dunkelziffer nach Einschätzung des LKA hoch ist? Erschüttert Sie das noch?
Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, eine Leidensgeschichte – oft auch Kinder, die mitbetroffen sind. Das sollte uns alle erschüttern. Der Anstieg kann verschiedene Ursachen haben: Es können tatsächlich mehr Gewalttaten passiert sein, etwa durch gesellschaftliche oder wirtschaftliche Belastungen. Er kann aber auch bedeuten, dass mehr Betroffene den Mut finden, Anzeige zu erstatten. Das wäre ein Zeichen für wachsende Sensibilisierung und Vertrauen in Hilfsangebote. Wichtig ist, weiter in Prävention, Schutz und Aufklärung zu investieren.

Annalena Schmidt ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. David Bieber sprach mit ihr über Ursachen und Prävention häuslicher Gewalt.
Wie sehen die Zahlen bundesweit aus?
Das »Lagebild Häusliche Gewalt« des Bundeskriminalamtes für 2024 wird erst demnächst veröffentlicht. Aber das Bundeskriminalamt hat uns bereits Zahlen genannt: 2024 wurden fast 266 000 Betroffene häuslicher Gewalt erfasst und damit 9666 mehr als im Vorjahr. Davon waren 171 069 Betroffene von Partnerschaftsgewalt betroffen. Davon waren 79,3 Prozent Frauen und 20,7 Prozent Männer. Frauen sind also weiter überproportional betroffen, zugleich erlebt auch eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Männern häusliche Gewalt.
Ihr Verein kümmert sich um männliche Opfer ...
Ja. Frauen sowie trans, inter und nichtbinäre Personen sind zwar überproportional betroffen, Männer häufiger Täter. Aber wenn Männer Opfer werden, suchen sie aus Scham oder Angst besonders selten Hilfe. Wir machen ihre Betroffenheit sichtbar, ohne andere Formen von Gewalt zu relativieren, und grenzen uns klar von antifeministischen Positionen ab.
Laut NRW-Statistik waren die meisten Opfer und Täter unter 40 Jahre alt. Ist häusliche Gewalt vor allem ein Problem junger Menschen?
Häusliche Gewalt betrifft grundsätzlich Menschen aller Altersgruppen und Lebensformen. Die Statistik der Männerschutzeinrichtungen zeigt: 2023 waren die Bewohner im Durchschnitt 39,9 Jahre alt, der jüngste 18, der älteste 78. Mehr als die Hälfte war aber tatsächlich zwischen 20 und 39 Jahren alt. In den Frauenhäusern waren laut Frauenhauskoordinierung 2024 sogar 69 Prozent der Bewohnerinnen zwischen 20 und 40 Jahren. Aber gerade ältere Gewaltbetroffene – insbesondere in Pflege- und Abhängigkeitsverhältnissen – werden statistisch kaum sichtbar.
Wie kann man individuell sicherstellen, dass der innerfamiliäre Umgang gewaltfrei bleibt?
Jeder kann dazu beitragen. Wer merkt, dass Überforderung wächst, sollte sich früh Unterstützung holen – im Freundeskreis, bei Beratungsstellen. Aber vor allem müssen sich gesellschaftliche Bedingungen verändern, die Gewalt begünstigen: ungleiche Machtverhältnisse, Armut, Care-Ungleichheit, starre Rollenbilder, Diskriminierung. Gewalt ist kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem. Sie endet nicht durch Appelle zur Selbstkontrolle, sondern durch gerechtere Strukturen, eine Kultur des Hinsehens und der Solidarität.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.