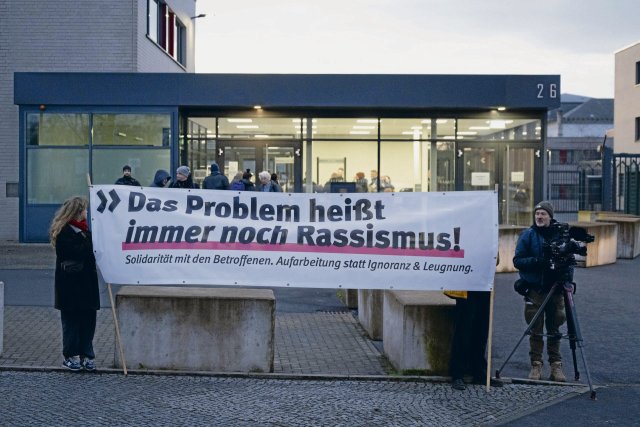- Politik
- Nukleare Teilhabe
Deutschland hält an der nuklearen Teilhabe fest
Piloten der Bundeswehr sind am aktuellen Nato-Manöver beteiligt, und die BRD will nicht auf in Büchel lagernde US-Atomsprengköpfe verzichten

Zum Atomkriegstraining »Steadfast Noon« gab es nur wenige routinierte Nachrichten. Zur deutschen Beteiligung hieß es von der Nato, die Bundeswehr stelle dafür drei für das Abwerfen von US-Atombomben ausgerüstete Tornados sowie vier Eurofighter bereit. Grund dafür, dass sie als Land ohne eigene Atomwaffen teilnimmt, ist die nukleare Teilhabe der Nato. Sie sieht vor, dass in Europa stationierte US-Wasserstoffbomen vom Typ B61 bzw. der neueren Variante B61-12 im Ernstfall auch von Flugzeugen von Partnerstaaten abgeworfen werden. Depots für diese Waffen befinden sich in Norditalien, in Belgien, den Niederlanden – und im rheinland-pfälzischen Büchel. Im dortigen Bundeswehr-Fliegerhorst sollen rund 20 davon lagern.
Über die nukleare Teilhabe hat die Nato jene Mitglieder in ihr Abschreckungskonzept integriert, die keine eigenen nuklearen Waffenarsenale haben, weil sie wie die Bundesrepublik den Atomwaffensperrvertrag alias Nichtverbreitungsvertrag (NVV) unterzeichnet haben. Die alte BRD trat dem Abkommen 1968 bei. Schon 1955 hatte sie offiziell auf die Herstellung eigener Atomwaffen verzichtet. Doch 1957 erfuhr die deutsche Öffentlichkeit, dass schon seit 1953 atomare US-Artilleriegeschosse in der BRD lagerten. Das war eine Initialzündung für die westdeutsche Friedensbewegung. Am 25. März 1958 billigte der Bundestag jedoch die Stationierung nachträglich.
»Deutschland bleibt Teil einer nuklearen Abschreckungslogik, die rechtlich, moralisch und sicherheitspolitisch zunehmend unhaltbar ist.«
Christoph von Lieven
Vorstand der deutschen Sektion der internationalen Antiatomwaffenkampagne Ican
Nach dem Nato-Doppelbeschluss von 1979 und dessen Billigung durch den Bundestag wurden dann Ende 1983 mehr als 100 Pershing-II-Raketen mit Atomsprengköpfen und Hunderte Tomahawk-Marschflugkörper stationiert, allen Massenprotesten zum Trotz. Begründet wurde dies mit der angeblich zu großen Zahl sowjetischer SS-20-Atomraketen im Ostblock. Doch schon damals kritisierten nicht nur Friedensforscher, sondern auch einige Nato-Generäle den destabilisierenden Effekt der Pershings und Tomahawks, die das Bündnis im Ernstfall zum »vollständigen Einsatz« zwingen würde. Die wahnwitzige Logik des »Use them or lose them«, also des vollständigen Einsatzes, um einer Vernichtung der eigenen Kapazitäten durch einen Erstschlag zuvorzukommen, herrscht unter den Verfechtern der »glaubwürdigen Abschreckung« letztlich weiterhin.
Einer kurzen Phase der Entspannungspolitik nach Abschluss des INF-Abrüstungsvertrags zwischen Sowjetunion und USA 1987 bis zum Abschluss der Vernichtung Tausender Atomwaffen bis 1991 folgte eine neue, zunächst noch vergleichsweise langsame Aufrüstungsphase, die seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 eine nie dagewesene Dynamik erreichte.
In Deutschland waren es vor allem die Außenminister, die sich zum Thema nukleare Teilhabe äußerten. Der letzte Amtsinhaber, der für einen Abzug der US-Sprengköpfe eintrat, war Guido Westerwelle im Jahr 2010. Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock stellte Ende 2021 kurz nach ihrem Amtsantritt wie ihre Vorgänger mit SPD-Parteibuch klar, dass es bei der Teilhabe bleibe. Das sei kein Widerspruch zum Ziel der Ampel-Koalition, bei Bemühungen um atomare Abrüstung eine Führungsrolle zu übernehmen.
Wie die Vorgängerregierung wollte auch die Ampel nicht dem Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beitreten, für dessen Initiierung die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen (Ican) den Friedensnobelpreis erhielt. Die deutsche Ican-Sektion kritisierte die aktuelle deutsche Beteiligung an »Steadfast Noon«. »Wer an einem atomaren Szenario teilnimmt, macht Standorte wie Büchel sowohl zum Ausgangspunkt als auch zum möglichen Ziel eines Atomschlags«, rügte ihr Vorstand Christoph von Lieven. Deutschland bleibe Teil einer »nuklearen Abschreckungslogik, die rechtlich, moralisch und sicherheitspolitisch zunehmend unhaltbar ist«.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.