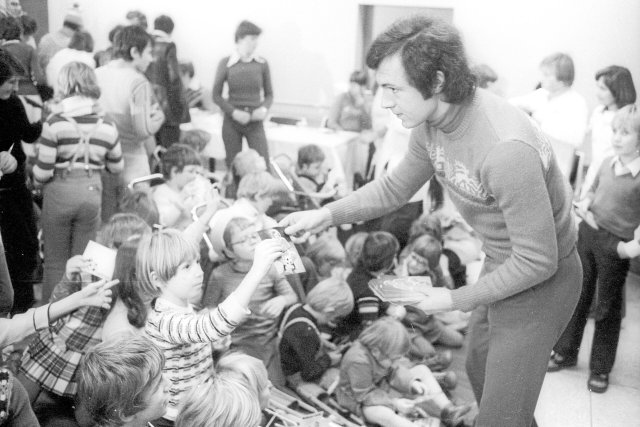- Kultur
- »Franz K.« im Kino
Kafka jenseits der Jubiläen
Agnieszka Hollands Film »Franz K.« ist eine Annäherung an das Phänomen Kafka

Das Kafka-Jahr liegt hinter uns, mitsamt seiner zahlreichen Dokumentationen und samt Fernsehserie über den Prager Weltautor, der so tief in die Schatten des 20. Jahrhunderts blickte. Wir sind gut unterrichtet über Kafka und das Kino, das er häufig besuchte, über Kafka und den Sport bei gleichzeitiger Phobie vor fremden Körpern, über den dominanten Vater und die Prager Unfallversicherung. Aber woher kommt der Schrecken in seinen Texten?
Kafka, scheint es, wusste alles über die Entfremdung des modernen Menschen, war jedoch nicht so depressiv, wie man es vermuten würde, sondern hielt sich die Unbilden des Lebens als Angestellter und mäßig erfolgreicher Schriftsteller mit Ironie vom Leibe. War also alles gar nicht so schlimm im Leben von Franz Kafka? Doch, war es – aber vor allem als Vision des kommenden Unheils, das Kafka wie ein Seismograf vorwegnahm. Machtanmaßung, Behördenwillkür, Gefangensetzung, Demütigung, Mord und Vertreibung – das kulminiert gewiss in der NS-Zeit, aber ist darauf keineswegs beschränkt. Kafka erkennt die Mörder (auch die Seelenmörder) in den Saubermännern, die den Menschen ihre nächtlichen Träume verbieten wollen. Nichts mehr soll sich ihrer Kontrolle entziehen, auch nicht unsere vertracktesten Träume!
Doch nun kommt, pünktlich ein Jahr zu spät zur allgegenwärtigen »Kafka war gar nicht dunkel«-Selbstfeier des dauerfröhlichen Zeitgeistes, Agnieszka Holland mit »Franz K.«, ihrer Annäherung an das Phänomen Kafka. Und das ist großes Kino, das dem Menschen Kafka dort das Geheimnis lässt, wo eines ist. Aber nicht alles im Leben Kafkas war Geheimnis. Agnieszka Holland, die 1948 in Warschau geborene Regisseurin, hat in Prag studiert – weil dies die Stadt Kafkas war. Jemand, der Fragen stellte, ohne auf die Antwort zu warten. Die Gefangensetzung des Einzelnen in einem anonymen Machtapparat schildert er in »Das Schloss«, ohne dabei den Sinn für das Absurde, das Lächerliche der Szenerie aus den Augen zu verlieren.
Und da war noch etwas für die junge Agnieszka Holland, die in der Zeit des Stalinismus aufwuchs: die Prager Kafka-Konferenz von 1963, mit der die Tabuisierung Kafkas in den sozialistischen Ländern aufgehoben wurde. Und damit kam ein Thema zur Sprache, das als Reformimpuls bis zum Prager Frühling 1968 und darüber hinaus wirkte: die Entfremdungsthematik auch im Sozialismus.
Das ist der Hintergrund für diesen Kafka-Film von Agnieszka Holland, der inzwischen 77-jährigen Regisseurin. Sie musste diesen Film machen – und das sieht man ihm an. Nur scheinbar ist es die konträre Kafka-Lesart zu einem anderen großen Regisseur: Steven Soderbergh. Dieser zeigte 1991 in »Kafka« mit Jeremy Irons in der Hauptrolle ein dunkles und künstliches Prag, zu dem das Wort »kafkaesk« passte. Kafka agierte hier wie eine der Figuren seiner eigenen Texte: ein von vornherein Verlorener, ein Untergeher, mehr noch: ein Verurteilter.
Das war der Mensch Kafka zweifellos auch – unheilbar an Kehlkopftuberkulose erkrankt, starb er mit 41 Jahren. Da war ihm seine Zeit tief fremd geworden. Kein Platz darin für einen so widersprüchlichen, schwierigen Menschen wie ihn. Als Autor und Mann meinte er versagt zu haben; als Soldat im Ersten Weltkrieg wollte er den Opfertod sterben, aber auch daraus wurde nichts.
Während Soderbergh in Schwarz-Weiß drehte und einen expressiven Stil bevorzugte, geht Holland einen anderen Weg. Das 20. Jahrhundert beginnt hell und voller Zukunftserwartung. Nur im Hause Kafka herrscht ein despotischer Vater (ein Geschäftsmann), der so fest mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen steht, dass die Fantasie und mit dieser jede feinere Regung zu ersticken droht.
Gleich am Anfang sehen wir Franz als Kind, wie ihm der Vater (großartig in seiner stupiden Verfettung des Herzens: Peter Kurth) eigenhändig die Haare schneidet. Aus dem Kind wird in derselben Szene ein Mann – und immer noch hantiert der Vater mit der Schere an seinem Kopf: Es geht noch kürzer, als wollte er dem Sohn die Flausen gleich mit aus dem Kopf herausschneiden.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Idan Weiss ist ein Franz Kafka, in den man sich erst hineinsehen muss. Er wirkt mitunter so harmlos und opportunistisch, dass man sich fragt, wie dieser Allerweltstyp solche Dämonologien wie die »In der Strafkolonie« geschrieben haben soll. Seinem Vater widerspricht er nie offen, umgeht ihn gleichsam mit Ironie. Da begreift man plötzlich, wie groß die Bedrückung sein musste für diesen eher konfliktscheuen Menschen, der sich nur schreibend gegen die Folter von Familie, Bürokratie und Literaturbetrieb zu wehren vermochte. Aber das dann auf eine so drastische Weise, die keinen Ausweg, keine Rettung in letzter Sekunde zulässt. Gibt es bei Kafka denn niemals so etwas wie Erlösung, fragte Anna Seghers, die mit »Der Ausflug der toten Mädchen« ja selbst einen ganz und gar ausweglosen Text geschrieben hatte, ebenso befremdet wie bewundernd. Nein, gibt es nicht.
Schließlich glaubt man Idan Weiss, dass Kafka der Schöpfer dieser Vernichtungs- und Folterwelten ist. Als er in Prag zum ersten Mal aus der »Strafkolonie« vorliest, schüchtern lächelnd und viel zu leise, da zeigt sich erst Unglauben in den Gesichtern der Zuhörer, dann Ekel und Entsetzen – manche laufen Türen knallend hinaus.
Agnieszka Holland baut hier ein surreales Kaleidoskop, das immer gut beleuchtet ist. Denn der Schrecken gespenstert nicht wie der Golem bei Gustav Meyering nachts durch die Prager Gassen, er kommt bei Tage und immer hellem Sonnenschein. Die »Strafkolonie« war durchaus ein Stück visionärer Realismus: Auschwitz wird hier bereits für möglich gehalten. Und tatsächlich enden drei Schwestern Kafkas als Jüdinnen im Vernichtungslager. Sein Freund Max Brod kann fliehen – und rettet das literarische Werk Kafkas, das der Autor nicht für aufhebenswert befunden hatte.
Das ist großes Kino, das dem Menschen Kafka dort das Geheimnis lässt, wo eines ist.
All diese verschiedenen Facetten und Zeitbezüge werden hier auf grandiose Weise ineinandermontiert: Es gibt bei Kafka weder eine linear verlaufende Zeit noch eine nacherzählbare Handlung. Und diesem Prinzip folgen Holland und Kameramann Tomasz Naumiuk nun auf virtuose Weise. Eben noch ging Franz Kafka Anfang der 20er Jahre über den Wenzelsplatz, und plötzlich sind da SS-Leute, die Juden müssen einen gelben Stern tragen. Dann wieder sehen wir eine Fremdenführerin heute, die Japanern den Badeplatz von Kafka zeigt. Für zwei Euro dürfen sie sich dort liegend fotografieren lassen. Kafka, der Prag nie verlassen hat, den man dort aber kaum kannte, ist heute ein Tourismusfaktor, mit dem Geld verdient wird. Prag, so hören wir hier, »ist eine Geliebte mit Krallen. Wenn man sie im Arm hält, lässt sie nie mehr los.«
Rilke hasste das enge, provinzielle und dunkle Prag, in dem er aufgewachsen war, und kehrte ihm früh für immer den Rücken. Auch der jüdische Autor Louis Fürnberg floh schließlich aus Prag, erst nach Palästina, dann in die DDR. Im kommunistischen Prag Ende der 40er Jahre sah er sich wieder als Jude bedroht, der Slánský-Prozess mit seinen Todesurteilen gab ihm recht.
Wollte Kafka in einer Stadt wie Prag auch deshalb bleiben, weil sie so harmlos wirkte, ohne es zu sein? Liebte er das Spiel mit dem schönen Schein, der immer lügt? Vielleicht faszinierten ihn vor allem paradoxe Situationen, etwa wenn er zu Felice Bauer (Carol Schuler) eine Nähe suchte, die er gar nicht wollte.
Kafka, das zeigt dieser ebenso erfahrungstiefe wie poetische Film, lebte keineswegs so, wie er es wollte. Aber dass er es nicht wollte, sein falsches Leben sogar abgrundtief hasste, das vertraute er nur seinen Texten an. Im Prager Alltag rettete ihn dagegen sein abgründiger Humor, mit dem er etwa den ausbleibenden Absatz seiner Bücher kommentierte: Zehn Exemplare seiner »Betrachtungen« seien schon verkauft worden, so berichtet er. Neun habe er selbst gekauft – aber wer war der Käufer des zehnten?
»Franz K.«, Tschechien 2025. Regie: Agnieszka Holland; Buch: Marek Epstein. Mit: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan, Katharina Stark, Sebastian Schwarz, Sandra Korzeniak, Carol Schuler. 127 Min. Kinostart: 23. Oktober.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.