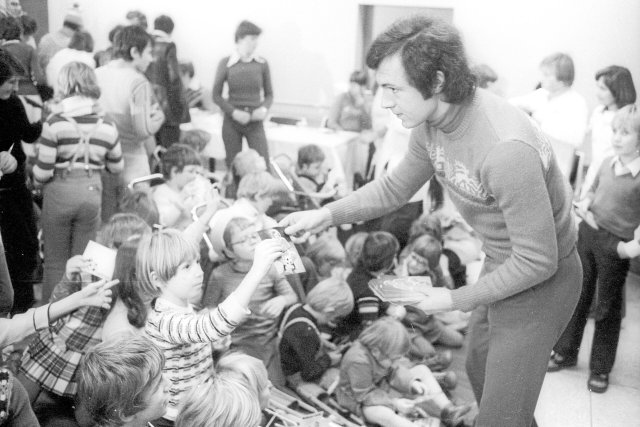- Kultur
- Ausstellung »Osten von Westen«
Ein heulender Honecker
Über die Ausstellung »Osten von Westen« im Schau Fenster in Berlin-Kreuzberg

Zwischen geschichtsträchtigen deutschen Daten eingeklemmt, vom 3. Oktober bis 9. November 2025, 35 Jahre nach dem Ende der DDR, gibt es in dem Kreuzberger Projektraum »Schau Fenster« in der Lobeckstraße, also unweit des Berliner Mauerstreifens, die Gruppenausstellung »Osten von Westen« zu sehen. Der Kurator Jan Kage hat in den letzten anderthalb Jahren mit Künstlerinnen und Künstlern, die in der DDR geboren wurden, Interviews geführt. FluxFM sendete die Gespräche, später druckte sie das Kunstmagazin »Monopol« ab. Die große Frage, die der gebürtige Bonner Kage seinen Gästen stellte, war die, ob es denn so etwas wie eine »Ost-Kunst« gebe. Die Befragten waren geteilter Meinung.
Die Arbeiten, die nun im »Schau Fenster« versammelt sind, kann man keineswegs auf einen Nenner bringen. Ihre Ausbildung haben die Beteiligten, zumindest zu Beginn, in DDR-Einrichtungen absolviert, alle gehen eigene Wege.
In der Mitte des Raumes finden sich zwei Gemälde von Else Gabriel. Mittlerweile ist sie Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, in den frühen Achtzigern mischte sie als Studentin in Dresden bei den Auto-Perforations-Artisten mit, die in ihren Performances in SM-artigen Outfits unter anderem mit Blut und Knochen hantierten. Sie ist vor allem mit einem Gemälde namens »Musen 2.0« in der Ausstellung vertreten. Es zeigt den (westdeutschen) Kunsttheoretiker Wolfgang Ullrich und den (ostdeutschen) Maler Neo Rauch, die vor einigen Jahren eine große Kontroverse hatten. Gabriel ist Krawall gewohnt und malt die beiden, ohne Schiedsrichterin zu spielen.
Im Gespräch mit Kage erzählt sie: »Also wenn man so eine Vakuole hat wie die DDR, ein Anhängsel, einen Wurmfortsatz, und dann innerhalb dieses Anhängsels noch eine Aussackung in dieser Elbschleife, wie ein Divertikel im Enddarm des Sozialismus, dann hat man wenig zu verlieren. Scheißegal. Der Letzte macht das Licht aus. Die gehen sowieso alle in den Westen. Ich will auch! Aber solange machen wir hier noch Rabatz, und zwar immer so, dass sie uns gerade nicht kriegen können.«
Gabriels Auto-Perforations-Kollege Via Lewandowsky hat zwei Objekte bereitgestellt: eine wippende Gitarre mit gerissener Saite, die vorgeblich Wolf Biermann gehörte und als »Das Ende vom Lied« betitelt ist. Und ein Honecker-Porträt, das per Schlauch Wasser aus den Augen lässt. Beides sind Beispiele für rebellische Versuche aus ihrer Zeit, gegen Muff und Repression anzugehen.
Der 1979 geborene Andreas Mühe, der aus einer berühmten Künstlerfamilie stammt, wurde als Kind von seiner Lehrerin gewarnt: »Wenn man rübergeht, darf man nichts essen, da vergiftet man sich.« Nachts hat er ein Wohnhaus in der Waldsiedlung Wandlitz fotografiert, wo bekanntlich die Mitglieder des Politbüros der SED lebten.
Architektur ist auch das Thema von Andrea Pichl. Sie beschäftigt sich fotografisch, filmisch, in Installationen mit der Sprache von Fassaden, der Beschaffenheit von Windfängen, verlassenem Gewerbe und zeigt Geschichte als Palimpsest, wie Bauten vom Untergang der Systeme erzählen.
»Die gehen sowieso alle in den Westen. Aber solange machen wir hier noch Rabatz, und zwar immer so, dass sie uns gerade nicht kriegen können.«
Else Gabriel Künstlerin
Der Maler Christian Thoelke, dessen Werke zurzeit auch im Potsdamer »Minsk« und im Kunstforum der Volksbank zu sehen sind, hat eine Zeichnung, »Durchblick klein«, beigesteuert, in der weiße Birkenstämme vor grauen Balkonen von Plattenbauten zu sehen sind. Auch wenn staatliche Gremien entschieden haben, was in der DDR ausgestellt wird, betont er im Gespräch mit Kage: »Du wirst im Osten weniger Menschen finden, die von vornherein sagen: Ich kenne mich damit [mit der Kunst] nicht aus, ich kann dazu nichts sagen. Der Zugang dazu war wesentlich niederschwelliger. Die Leute fühlen sich einfach damit verbunden.«
Sein Radeberger Kollege Thomas Scheibitz, der Steinmetz gelernt hat und in den Neunzigern international berühmt und erfolgreich wurde, meint wiederum: »Auftragskunst oder Kunst, die von einem Staat beziehungsweise seinen Organen oder Institutionen in Auftrag gegeben wird, ist nie ganz auf dem Punkt.«
Die Arbeiten, die man in der Ausstellung »Osten von Westen« sehen kann, sind vielleicht deshalb »auf dem Punkt«, weil man nicht den Eindruck gewinnt, dass sie mit fremdverordneten Gewissheiten oder Pseudostandpunkten operieren, allzu sehr auf einen statischen Ost-West-Diskurs abzielen oder sich bemühen zu gefallen. Die Beteiligten suchen Bilder, in denen die politische Vergangenheit und die Kunstgeschichte nicht gestrichen wurden, aber doch in eine Zukunft weisen, die noch nicht bestimmt ist.
»Osten von Westen«, bis 9. November im Schau Fenster, Raum für Kunst, Lobeckstraße 30–35, Berlin.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.