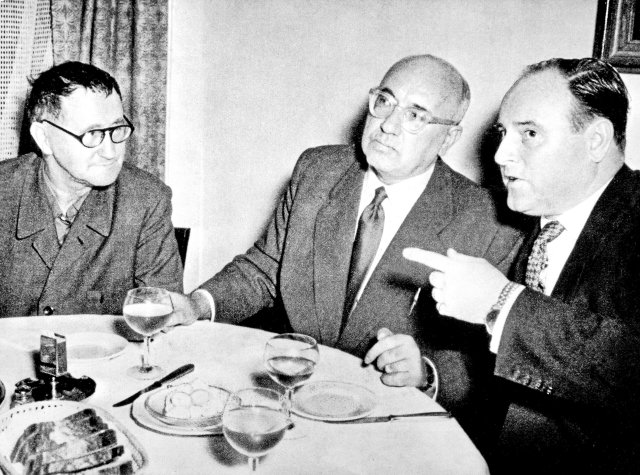- Kultur
- Gedenken an den Faschismus
Opa war im Krieg
Das deutsche Gedenkregime zur Beruhigung des Gewissens

Vor Kurzem wäre mein Vater, wenn er noch lebte, 101 Jahre alt geworden. Er und ich haben, solange er lebte, kein einziges normales Gespräch geführt. Denn er war dazu nicht in der Lage. Und ich auch nicht. 1943, im Alter von 19 Jahren, wurde er in die Wehrmacht eingezogen und zu einer Art militärischem Schnellkurs nach Frankreich abkommandiert. Nach drei Wochen Exerzieren wurde er mit dem Zug in die Ukraine gebracht, wo er seine Pflicht als Wehrmachtssoldat tat. Als ich ein Jugendlicher war, fragte ich ihn gelegentlich nach seinen Erlebnissen dort, doch die kargen Auskünfte und Antworten, die er mir gab, waren unbefriedigend: Geschichten davon, wie er mit seinem Pferd unterwegs war, Meldungen überbringen musste. Meine Erinnerung daran ist verblasst. Sein Leben lang hat er abgestritten, an Gräueltaten der Wehrmacht beteiligt gewesen zu sein oder davon gewusst zu haben. Aber das will nichts heißen. Spätestens ab dem 8. Mai 1945 haben alle Deutschen alles abgestritten und von heute auf morgen von nichts gewusst. Das Nichtsgewussthaben sollte neben dem Nichterinnernkönnen fortan für Jahrzehnte die Hauptbeschäftigung der Deutschen sein.
Der Soldat Blum konnte jedenfalls seine Pflicht nicht lange tun: Anfang 1945, als die Wehrmacht auf dem Rückzug war, wurde er von der Roten Armee aufgegriffen. In der Folge musste er durchmachen, was deutsche Wehrmachtsangehörige in sowjetischer Gefangenschaft durchmachen mussten: schwere Arbeit, Hunger, Seuchen. Mein Vater war damals jung, kräftig, robust, Sohn von Kleinbauern. Bevor er Soldat wurde, hatte er – nach sieben oder acht Jahren »Volksschule« in der Provinz – den Beruf des Schmiedes gelernt. Zwei Mal, so behauptete er später wiederholt, sei ihm in den fünf Jahren Kriegsgefangenschaft das Leben gerettet worden: einmal von einem deutschen Offizier, der eine Penicillinspritze eingeschmuggelt hatte, einmal von einer russischen Frau, die offenbar Mitleid mit dem Deutschen hatte und ihm heimlich eine selbstgemachte Salbe gab.
Nachdem er 1950 aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war, war er ein verbitterter, kaltherziger Mensch, gezeichnet von Alexithymie im fortgeschrittenen Stadium (natürlich undiagnostiziert). Und sowohl die Begrenztheit seines Verstandes als auch der stahlharte Starrsinn, mit dem er – sieht man von seinen märchenhaften, der nachträglichen Selbstheroisierung dienenden Gefangenschaftserzählungen ab – jegliche Beschäftigung mit der NS-Zeit zurückwies, hinderten ihn daran, seine Schuld zu begreifen oder gar einzugestehen: Er war besessen von der Vorstellung, »der Russe« sei nicht nur verantwortlich für das von ihm als Kriegsgefangener Erlittene und den verlorenen Weltkrieg, sondern für den Krieg insgesamt. Jahrzehntelang murrte oder schimpfte er vor dem Fernseher vor sich hin, wenn in den Abendnachrichten von Plänen der Sowjetunion die Rede war oder von einer »Entschädigung« für Holocaust-Überlebende.
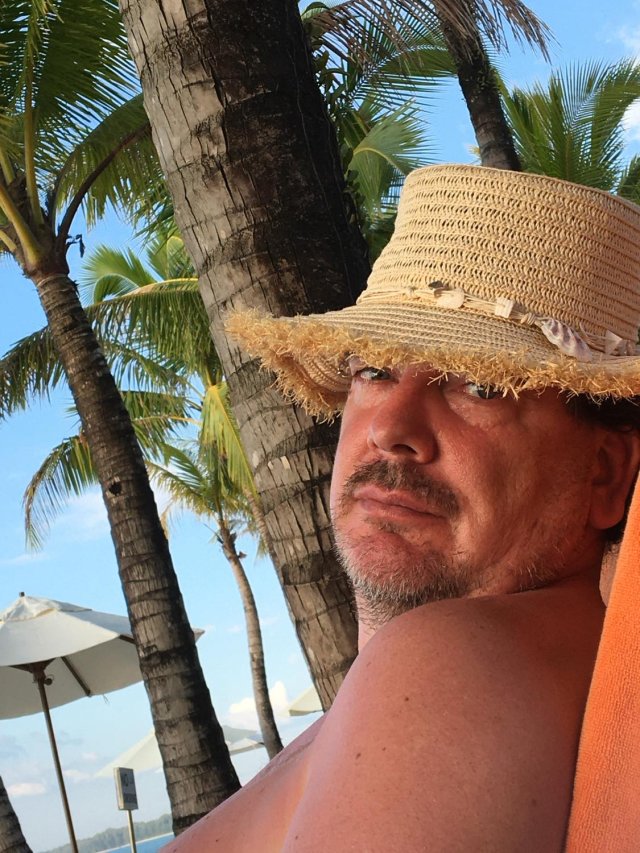
Thomas Blum ist grundsätzlich nicht einverstanden mit der herrschenden sogenannten Realität. Vorerst wird er sie nicht ändern können, aber er kann sie zurechtweisen, sie ermahnen oder ihr, wenn es nötig wird, auch mal eins überziehen. Damit das Schlechte den Rückzug antritt. Wir sind mit seinem Kampf gegen die Realität solidarisch. Daher erscheint fortan montags an dieser Stelle »Die gute Kolumne«. Nur die beste Qualität für die besten Leser*innen! Die gesammelten Texte sind zu finden unter: dasnd.de/diegute
Ich erzähle das, weil mein Vater, der vor einigen Jahren verstarb, ein typisches Beispiel war für das Schweigen, die Verhärtung und die Relativierung der deutschen Schuld: Ein politisches Koordinatensystem – rechts, links, Mitte – hatte er nicht, wie die meisten Deutschen. Vom Holocaust wollte er nichts wissen und nicht davon sprechen, wie die meisten Deutschen. Als seien ihre Verbrechen und die fabrikmäßige Ermordung von Millionen Menschen nie oder nur in einer Art legendenhaft-wundersamen Paralleluniversum unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Und wie die meisten Deutschen sah er sich als Opfer des Krieges, nicht als Täter: Er sei eingezogen worden, dagegen habe er nichts unternehmen können. Schuld an allem habe der Russe, der ihm jahrelang das Leben zur Hölle gemacht habe.
Diese Kultur des Schweigens, des Nichtwissenwollens, der Schuldumkehr und des mal verschämter, mal freimütiger praktizierten Umlügens von Tätern zu Opfern existiert bis heute. Schon für die Generation nach meiner, die sogenannten Millennials (geboren zwischen 1981 und 1995), war der Holocaust in weite Ferne gerückt: Opa war, als er jung war, früher mal Soldat in irgendeinem Krieg.
Die jüngste Ausprägung dieser Kombination aus Geschichtsvergessenheit und Schuldverschiebung findet sich in dem obszönen Slogan »Free Palestine from German guilt«, den zurzeit meist junge Deutsche brüllen, die sich irrigerweise für Linke halten und denen nicht auffällt, dass der Spruch von jedem Nazi mitgebrüllt werden kann.
Diese Kultur des Schweigens, des Nichtwissenwollens, der Schuldumkehr und des mal verschämter, mal freimütiger praktizierten Umlügens von Tätern zu Opfern existiert bis heute.
Gewiss: Es gab und gibt bis heute offizielle Gedenkveranstaltungen, bei welchen der Bundespräsident (oder wer halt sonst gerade verfügbar ist unter den führenden Amtsträgern der Republik) seine Standard-Trauermiene aufsetzt und die erwartbaren Standardfloskeln von sich gibt: Erinnerung bewahren, unsere Verantwortung, wir Deutsche, was geschehen ist, die dunkle Zeit, gegen das Vergessen, Lehren aus der Geschichte, nie wieder, Würde des Menschen, in diesem unserem Land.
Schließlich gilt der deutsche Staat – dem es dank einer gewissen Zähigkeit gelungen ist, dieses Image zu etablieren – heutzutage als »Vergangenheitsaufarbeitungsweltmeister«. Doch alle Beteiligten und die Zuschauer wissen, dass es sich bei all den im Lauf der Jahrzehnte aufwendig inszenierten Erinnerungs- und Mahnungsfestspielen um ein leeres Ritual mit der immer gleichen Dramaturgie handelt. Eine Art Trauer- und Gedenkzirkus, der, zu feststehenden Terminen, hauptsächlich um der Medien und der Weltöffentlichkeit willen aufgeführt wird.
Der Großteil der deutschen Bevölkerung betrachtet das seit jeher entweder mit genervtem Augenrollen oder mit Unmut. Um in diesem Punkt bestätigt zu werden, musste man früher nur einen Blick in die Leserbriefspalten irgendeiner Zeitung werfen, wo dieselben revanchistischen und antisemitischen Sprüche geklopft wurden wie heute – noch ungehemmter und schrankenloser – auf den Social-Media-Plattformen. Oder in TV-Talkshows, die ein sogenanntes Zuschauertelefon eingerichtet hatten: »Das ist doch alles lange her«, »die Juden sollen mal eine neue Platte auflegen«, »muss man uns täglich mit dem Judenthema kommen?«, »irgendwann muss auch mal Schluss sein«, »die Vergangenheit endlich ruhen lassen«, »die Juden sollten besser mal schauen, was sie mit den Palästinensern machen« undsoweiter, undsoweiter. Man kann heute Äußerungen wie diese täglich überall hören und lesen.
Ich bin mir nicht sicher, ob eine bessere Zukunft mit Leuten wie diesen zu machen ist. Sicher ist jedenfalls: Die Vergangenheit interessiert sie nicht.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.