- Politik
- Interview mit Nandita Sharma
»Die Grenze ist ein System, um Menschen ungleich zu behandeln«
Die indisch-kanadische Soziologin Nandita Sharma über Nationalstaaten, Migrationspolitik und Rassismus

Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so global denkt wie Sie. In Ihren Arbeiten kritisieren Sie nicht nur Grenzen und Migrationspolitik, sondern stellen grundsätzlich infrage, dass sich mit Nationalstaaten progressive Politik machen ließe. Vielleicht können Sie erst einmal ein wenig über sich erzählen, damit man versteht, wie Sie Ihre Positionen entwickelt haben.
Als wir 1969 aus Indien nach Kanada auswanderten, war das für unsere ganze Familie ein großer Schock. Mein Vater gehörte zu der ersten Kohorte Einwanderer, die nach Kanada einreisen durften, nachdem das Land die rassistischen Migrationsverbote für Nicht-Weiße abgeschafft hatte. Weil die Berufsabschlüsse meines Vaters nicht anerkannt wurden – er war Ingenieur –, lebten wir in ziemlicher Armut. Dazu kam ein brutaler Rassismus. Uns wurde täglich vermittelt, dass wir »nicht hierhergehören«. Einmal wurde mein Vater mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen. Das hat mich dazu gebracht, grundsätzlich über das Migrant-Sein nachzudenken.
Und das hat Sie dann auch politisiert?
Mein Vater war Kommunist, ich bin also in einem sehr politischen Umfeld aufgewachsen. Weil er in Kanada wenig verdiente, musste meine Mutter unter anderem als Landarbeiterin jobben. Mein Bruder und ich sind im Sommer mit zur Arbeit, es gab ja keine Kinderbetreuung. Ich habe also früh mitbekommen, wie hart die Arbeitsbedingungen auf den Farmen waren. Als Teenager habe ich mich dann in einer Organisation engagiert, die Landarbeiter gewerkschaftlich organisierte. Es war zugleich die Zeit, als in Vancouver eine antirassistische Bewegung entstand. Mein Aktivismus hatte also mit beidem zu tun: mit ökonomischer Ausbeutung und mit Rassismus. Damals habe ich auch begriffen, dass Ausbeutung danach ausdifferenziert wird, welchen Migrationsstatus man hat: unbefristeten Aufenthalt, begrenzte Arbeitserlaubnis oder undokumentiert.
Aber Sie wurden nicht einfach Migrationsforscherin, sondern eine radikale Kritikerin der Nation.
Eigentlich komme ich von der anderen Seite: Meine Eltern wurden beide noch als Untertanen des britischen Empires geboren, meine Großväter kämpften gegen die Briten, in meiner Familie wurde die nationale Befreiung Indiens gefeiert. Aber wie gesagt: In Kanada habe ich mit undokumentierten Arbeiter*innen gearbeitet, und als 1999 Boote mit chinesischen Menschen nach Vancouver kamen, habe ich erlebt, dass alle abgewiesen wurden. Mich hat das dazu gebracht, den Blick von den »Migranten-Rechten« hin zur Funktion der Grenze zu wenden. Ich würde sagen, dass jede Migrationspolitik darauf abzielt, Menschen Rechte vorzuenthalten. Oder anders ausgedrückt: Die Grenze ist ein System, um Menschen ungleich zu behandeln. Deshalb kann es so etwas wie eine »faire Migrationspolitik« nicht geben.

Nandita Sharma wurde in Indien geboren und kam 1969 im Alter von fünf Jahren als Tochter von Arbeitsmigrant*innen nach Kanada. Über den politischen Aktivismus fand sie zur Wissenschaft und arbeitet heute als Soziologin an der University of Hawaii in Manoa. Sie forscht zur Funktion von Grenzen und zur Geschichte der Migrationspolitik. In ihrem Buch »Home Rule« (Duke University Press 2020) untersucht sie, wie Nationalstaaten die Unterscheidung zwischen Staatsbürgern und Migranten einführten.
Ich weiß, dass Sie mit dem marxistischen Historiker Marcus Rediker befreundet sind. Aber Ihre Arbeit kommt eigentlich eher aus einem feministischen Zusammenhang. Was war da entscheidender?
Das kann ich nicht so eindeutig sagen. Was sicher stimmt, ist, dass das Buch »Die vielköpfige Hydra« von Peter Linebaugh und Marcus Rediker mich sehr beeinflusst hat. Es zeichnet nach, wie ab dem späten 16. Jahrhundert ein globaler Kapitalismus und so etwas wie eine globale Klasse entstanden. Linebaugh und Rediker zeigen, dass es in dieser Klasse trotz unterschiedlicher Kategorien, denen die Menschen durch die Staaten zugeordnet wurden, immer Solidarität gab. Die Idee der Nation war ein Mechanismus, um die Menschen, die das kapitalistische System unter anderem auf den Schiffen zusammengebracht hatte, wieder zu spalten. Diese Perspektive war wirklich inspirierend für mich. Sie vermittelte mir, worum es in meinem politischen Aktivismus eigentlich geht: nämlich darum, die Spaltung durch nationale und »rassische« Kategorien wieder aufzuheben. Eigentlich hatte ich vor, Anwältin für Migrationsrecht zu werden. Aber als ich merkte, dass man die Verhältnisse grundsätzlicher infrage stellen muss, habe ich mich der Soziologie zugewandt. Wissenschaft und Aktivismus waren für mich nie zu trennen.

Die Rechte ist weltweit auf dem Vormarsch und überall steht die Staatsgrenze im Mittelpunkt der rechten Projekte. Ich habe den Eindruck, dass viele Linke – auch ich selbst – noch nicht wirklich begriffen haben, warum das so ist.
Ich würde auch sagen, dass die Grenze und die Kategorie des Migranten im Zentrum des faschistischen Sturms stehen. Aber wie lässt sich das erklären? Wir müssen zunächst einmal sehen, dass die imperiale Form der Staatsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg fast überall in der Welt durch die nationalstaatliche ersetzt wurde – sowohl in Europa, also den ehemaligen Kolonialmächten, als auch in den früheren Kolonien im Süden. Der Nationalstaat verspricht sehr viel: Gleichheit, soziale Dienstleistungen, Jobs, Freiheit … Aber er kann das überhaupt nicht leisten. Denn alle Nationalstaaten – die starken wie die schwachen – operieren in einem kapitalistischen Weltsystem, das ohne Ungleichheit und Unterdrückung strukturell nicht existieren kann. Die wichtigste Dichotomie wiederum, die der Nationalstaat produziert, ist die zwischen Staatsbürger*in und Migrant*in. Bürger*innen sind diejenigen, für die der Staat da sein soll; Migrant*innen jene, die »nicht dort hingehören«. Die Figur der Migrant*in ist eine absolute essenzielle Kategorie für jeden Nationalstaat. Jeder Nationalstaat beweist seine Souveränität durch die Einführung von Migrationskontrollen und der Unterscheidung zwischen Staatsbürger*innen und Migrant*innen. Und der Migrant wird zum Alibi für die unerfüllten Versprechen des Nationalstaats. Wenn es keine Wohnungen gibt, das Gesundheitssystem unterfinanziert ist, Löhne schlecht bezahlt sind, liegt das nicht am Kapitalismus, sondern an den Migrant*innen. Die faschistischen Bewegungen spitzen das nur zu: »Wenn ihr die Migranten vertreibt, wird das eure Probleme lösen.«
Sie betonen, dass die kapitalistische Moderne beides hervorbringt: Mobilität und Grenzschließung. Der Kolonialismus verschleppte Millionen Menschen gewaltsam – übrigens nicht nur Afrikaner*innen. Auch die meisten Europäer*innen kamen als Zwangsarbeiter, als Indentured Labour, in die Kolonien. Aber diese Menschen sollten sich dann nicht frei bewegen können.
Selbstverständlich wollen alle Staaten – seit dem Entstehen derartiger Strukturen vor 5000 Jahren – die Mobilität von Menschen kontrollieren. Staaten sind Klassenprojekte, und in diesem Sinne geht es ihnen um ausbeutbare Arbeitskraft. Imperiale Staaten machen das allerdings ganz anders als Nationalstaaten. Sie wollen so viele Menschen wie möglich in einem Territorium halten, weil Arbeit die Quelle des Reichtums und der politischen Macht ist. Nationalstaaten hingegen etablieren Einreisekontrollen, die Einwanderung nicht grundsätzlich verhindern sollen, durch die aber bestimmte Rechte vorenthalten werden können. Beim Übergang von der imperialen zur nationalstaatlichen Form spielte das Ende der Sklaverei eine zentrale Rolle. Das Ende der Sklaverei wurde von einer weltweiten abolitionistischen Bewegung erkämpft – und zwar gegen die reichsten Menschen der damaligen Zeit, die Plantagenbesitzer*innen. Als es zur Abschaffung der Sklaverei kam, flippten die Kapitalist*innen im britischen Kolonialreich regelrecht aus. Für sie stellte sich die Frage, wie sie an die Arbeitskraft für ihre Plantagen kommen sollten. Denn natürlich arbeitet niemand freiwillig auf einem Zuckerrohrfeld. In diesem Kontext setzte sich das Kuli-System durch. Kontraktarbeiter*innen aus China und Südasien wurden auf die Plantagen gebracht, und parallel dazu begann das britische Empire die ersten Migrationskontrollen zu etablieren. Einwanderungsgesetze waren ein Instrument, um die Kontrolle über die Mobilität der Menschen zu bewahren. Sie erlaubten es, Menschen an bestimmten Orten und in bestimmten Jobs zu halten. Die Kulis durften in ein reicheres Land einwandern, aber nur unter scharfen Auflagen, die sie faktisch zu Zwangsarbeiter*innen machten.
»Jede Migrationspolitik zielt darauf ab, Menschen Rechte vorzuenthalten.«
Sie sagen, dass mit der massenhaften Verschleppung von Menschen ab dem 16. oder 17. Jahrhundert ein globales Proletariat geschaffen wurde. Wenn ich Sie richtig verstehe, waren Rassifizierung und Grenzen dann Instrumente, um diese Klasse wieder auseinanderzudividieren.
Ich würde erst einmal infrage stellen, ob imperiale Staaten bereits Grenzen kannten. Imperien beanspruchten Territorien und deshalb gab es natürlich Grenzlinien zwischen den Imperien. Aber diese Grenzen hatten nur für die Staaten Bedeutung; sie dienten nicht der Migrationskontrolle. Imperien waren sehr zufrieden, wenn jemand einwanderte. Der transatlantische Sklavenhandel war ja genau das: ein imperiales Projekt, um Menschen dorthin zu bringen, wo das Kapital sie benötigte. Wichtig wurden die Grenzen erst mit der Abschaffung der Sklaverei in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber das globale Proletariat war natürlich schon vorher durch den Rassismus und die Idee der nationalen Zugehörigkeit gespalten worden. Man könnte vielleicht sagen, dass sich die Unterscheidungen weiterentwickelten: Freier und Sklave, Schwarz und Weiß, Staatsbürger und Migrant. Nationalismus und Grenze brachten eine neue, zusätzliche Kategorie von Rassismus hervor: die des Migranten.
In Ihrem Buch »Home Rule« schreiben Sie an einer Stelle, dass »Menschen, die als Männer ge-gendered und als Weiße rassifiziert wurden«, privilegierte Zugangsmöglichkeiten zu bezahlter Arbeit erhielten. Die anderen hingegen mussten unfrei oder unbezahlt arbeiten. Vom britischen Theoretiker Stuart Hall gibt es ja die berühmte Formulierung, Race sei eine Erscheinungsform von Klasse. Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte man etwas Ähnliches auch über das Geschlecht sagen.
Absolut. Die Konstruktion der Differenz zwischen Männern und Frauen war eine entscheidende Voraussetzung für die Expansion des Kapitalismus. Wer diesen Zusammenhang verstehen will, sollte Silvia Federici lesen. Im Kapitalismus wird den Menschen, die als Frauen gelten, das verweigert, was für das Überleben in kapitalistischen Gesellschaften entscheidend ist: der Zugang zu Lohn. Dass die Mächtigen einem Teil der Beherrschten diesen Zugang vorenthielten, senkte nicht nur die Kosten der Arbeitskraft. Es spaltete die Arbeitskraft auch und erhöhte die Zustimmung der Männer zu diesem System. Ich würde sagen, dass die Männer sich selbst besiegten, als sie entschieden, Frauen als ihre Untertanen zu behandeln. Aber sie selbst hielten das – und viele halten es immer noch – für einen Sieg. Das ist ein Punkt, den ich in meiner Arbeit immer stark zu machen versuche: die zentrale Bedeutung der Solidarität.
Sie sagen, dass die Unterscheidung zwischen Migranten und Einheimischen in postkolonialen Gesellschaften wie Indien vom britischen Empire erfunden worden sei. Machen Sie es hier nicht zu einfach? Auch traditionelle Gemeinschaften unterscheiden doch zwischen Angehörigen der eigenen Gruppe und Fremden.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir genug über die Geschichte der Menschheit wissen, um pauschale Aussagen wie »alle Menschen haben zwischen Einheimischen und Fremden unterschieden« treffen zu können. Dass es überall auf der Erde Menschen gibt, liegt daran, dass es Migration gab. Niemand von uns kommt von einem bestimmten Ort. Wir alle stammen von Menschen ab, die Ostafrika verlassen haben. Vor diesem Hintergrund würde ich behaupten, dass die Unterscheidung zwischen Einheimischen und Migranten in einem großen Teil der Menschheitsgeschichte keinen Sinn ergab. Mich interessiert die Frage, wann und warum diese Unterscheidung auftauchte.
Nämlich?
Meiner Meinung nach gewann die heute existierende Unterscheidung an Bedeutung, als es darum ging, Menschen auseinanderzudividieren. Es ging darum, sie zu schwächen. Nehmen wir das britische Empire. Der indische Aufstand von 1857 jagte den Kolonialherren ungeheure Angst ein. Schon lange vor der Erfindung des Radios breiteten sich Nachrichten über Aufstände rasend schnell aus, denn Arbeiter*innen reisten mit ihren Berichten durch die Welt. Die britischen Kolonialherren entwickelten deshalb eine Strategie, um ihre Untertanen auseinanderzudividieren. Bis dahin hatte nur die Unterscheidung zwischen Kolonialherren und »Eingeborenen« eine Rolle gespielt. Jetzt war von »eingeborenen« und »zugezogenen Einheimischen« die Rede. Indem das Empire beiden Gruppen unterschiedlichen Zugang zu Rechten, zum Beispiel zum Land, gewährte, brachte es die Gruppen gegeneinander auf. Und die postkolonialen Nationalstaaten übernahmen diese Unterscheidung. Man denke nur an Myanmar, wo die Rohingya in Konzentrationslagern interniert werden, weil man sie als Migranten definiert.

Die Philosophin Hannah Arendt hat von der Staatsbürgerschaft als das »Recht, Rechte zu haben«, gesprochen. Bei Arendt ist das als Kritik gedacht, aber man könnte es auch umgekehrt verstehen: Grundlegende Rechte werden heute nur von Staaten garantiert, und deshalb sollten wir Nationalstaaten verteidigen, die über diese Mindeststandards wachen.
Ich würde sagen, dass diese Rechte uns in ein System einbinden sollen, das letztlich gegen uns arbeitet. Klassenherrschaft hat sich immer durch das Zusammenspiel von Terror und Gnade ausgezeichnet. Ein großer Teil der Europäer*innen, die nach Nordamerika gelangten, kamen als Unfreie, als Indentured Labour. Sie wurden in Europa auf den Straßen eingesammelt und auf Schiffe gezwungen. Dass man ihnen gegen Ende des 17. Jahrhunderts als »Weiße« die Freiheit gewährte und von da an nur noch diejenigen versklavt wurden, die man als »Schwarze« definiert hatte, war ein Schachzug, um die Herrschaft zu stabilisieren. Was ich sagen will: Die Gnade, die einigen zuteilwurde, war vom Terror gegen andere nicht zu trennen. Staatsbürgerschaft und Migrationspolitik müssen wir als ganz ähnliche Instrumente der Spaltung begreifen. Den Staatsbürger*innen wird die Gnade gewährt, einige Rechte zu besitzen. Der volle Terror hingegen entfaltet sich gegen diejenigen, die als Migrant*innen kategorisiert werden. Doch auch wir, die wir als Staatsbürger*innen gelten, sollten begreifen, dass wir in einer kapitalistischen Welt aus Nationalstaaten leben, in der wir den Wünschen der Mächtigen ausgeliefert sind. Und auch in den reichen Staaten wird der Zugang zum Wohlfahrtsstaat immer weiter eingeschränkt: Immer weniger Menschen kommen in den Genuss von Gesundheitsversorgung und öffentlicher Bildung. Warum? Weil es an Solidarität fehlt. Weil die Erzählung breit akzeptiert wird, wonach die Migrant*innen – und nicht etwa das Kapital und die staatliche Politik – am Abbau des Wohlfahrtsstaates schuld sind. Die Existenz eines Sündenbocks erlaubt es den Mächtigen, soziale Rechte abzubauen.
Das Bemerkenswerte an Ihrer Perspektive ist, dass sich Ihre Kritik auch gegen die nationalen Revolutionen im Globalen Süden richtet. Sie sagen, dass die Entkolonisierung eine Farce war und die Machtverhältnisse sogar noch weiter verschärfte.
Um das zu erklären, hat man in den 60er Jahren die Theorie des Neokolonialismus entwickelt. Ihr zufolge ist die Entkolonisierung gescheitert, weil es noch nicht genug nationale Souveränität gibt. Nach dem Motto: »Wir werden von internationalen Institutionen fremdbestimmt und müssen deshalb noch nationalistischer werden.« Ich hingegen würde behaupten, dass Linke, die das vertreten, nicht begriffen haben, was es mit der Ordnung der Nationalstaaten auf sich hat. Man kann dem Kapitalismus nicht durch die Errichtung souveräner Nationalstaaten entkommen.
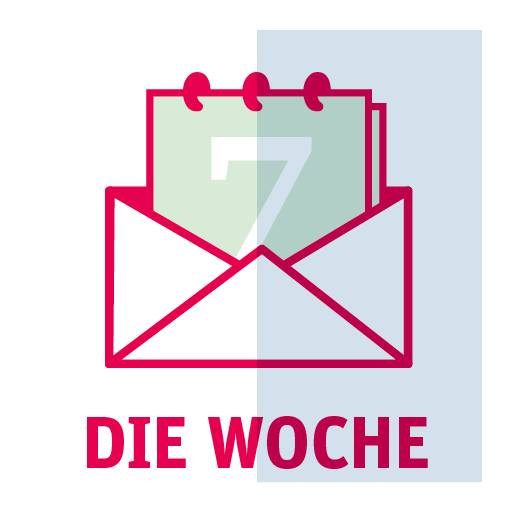
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Sie schreiben auch, dass die postkoloniale Staatenordnung im Wesentlichen den Interessen der USA entsprang.
Natürlich wurde die Entkolonisierung auch von unten, den Kolonisierten, erkämpft. Aber gleichzeitig war sie auch im Interesse der USA, die die imperiale Bühne erst relativ spät betraten. Die USA hatten zwar große Teile Nordamerikas kolonisiert, aber konnten im Rest der Welt nicht mit dem britischen und französischen Kolonialreich konkurrieren. Diese Imperien waren geschlossene Märkte. Das heißt, man konnte als New Yorker Kapitalist nicht einfach in eine Plantage des britischen Kolonialreichs investieren. Und deshalb wurde das Ende des Kolonialismus zu einer wichtigen US-amerikanischen Forderung. Der Zweite Weltkrieg bot eine günstige Gelegenheit hierfür. Frankreich war von Nazideutschland besetzt worden, Großbritannien stark geschwächt. Vor diesem Hintergrund knüpften die USA ihre Unterstützung der europäischen Kolonialmächte an die Bedingung, dass allen kolonisierten Völkern am Ende des Kriegs die nationale Selbstbestimmung gewährt werden müsse. Und genau das ist dann auch geschehen. Das Kapital expandierte, und noch mehr Menschen wurden in die globalen Ausbeutungsbeziehungen gezwungen. Ich würde sagen, dass die De-Kolonisierung das kapitalistische Weltsystem neu geordnet hat. Für die meisten von uns, die wir aus den früheren Kolonien kommen, hat sich das Leben dadurch noch weiter verschlechtert. Wir werden durch Menschen ausgebeutet, die vielleicht wie wir selbst aussehen, aber genauso brutal und rücksichtslos vorgehen wie die alten Kolonialherren.
Sie erwähnen, dass 21 der 85 reichsten Menschen weltweit aus dem Globalen Süden kommen … Und was mir auch nicht bewusst war, ist, wie sehr die postkolonialen Staaten Rassifizierungskonzepte kopierten: In Uganda und Fidschi wurden Inder ausgebürgert. Der linke Panafrikanist Nkrumah warf nach der Unabhängigkeit Ghanas »Nigerianer« aus seinem Land. In Süd-Sudan muss man heute besonders schwarz sein, um Staatsbürger sein zu können ... Ich frage mich allerdings, ob nicht auch andere, diversere Nationalidentitäten vorstellbar sind. In Lateinamerika etwa gibt es in vielen Ländern eine plurinationale Definition nationaler Identität.
Aber warum sollten wir hier stehen bleiben? Warum können wir die Grenzen unserer Gesellschaft nicht so wahrnehmen, wie sie tatsächlich existieren? Wir leben in einer Gesellschaft planetaren Ausmaßes, wir sind global voneinander abhängig. Aber unsere Vorstellungskraft beschränken wir auf Nationalidentitäten. Außerdem produzieren Nationalstaaten immer einen »Anderen«, und wenn der Nationalstaat seine Versprechen nicht einlösen kann, wird er diesen »Anderen« dafür verantwortlich machen. Und wie gesagt: Nationalstaaten können aus strukturellen Gründen nicht bereitstellen, was wir benötigen: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit.
Ihre Kritik bezieht sich nicht nur auf Nationalstaaten, sondern auf alle – auch indigene – Gemeinschaften, die Souveränität über ihr Territorium beanspruchen. Was bedeutet Ihre Position, wonach der Migrant dasselbe Recht hat, an einem Ort zu leben wie der Einheimische, eigentlich für Palästina und die Kritik am Siedlerkolonialismus?

Die israelisch-palästinensische Horror-Show ist ein emblematisches Beispiel für das Problem, um das es geht. An der Geschichte Israels sehen wir, dass jedes Nationalprojekt auf Enteignung und Vertreibung beruht. Aber gleichzeitig würde dieser Schrecken durch die Gründung eines palästinensischen Nationalstaats nicht beendet. Die Palästinenser*innen werden das, was sie verdienen – eine gerechte Gesellschaft –, nicht durch einen Staat erreichen. Ich glaube, wir müssen unsere Vorstellungen verändern, wofür und gegen wen wir eigentlich kämpfen. Solange wir uns in Nationen spalten lassen, wird sich unsere Lage weiter verschlechtern.
Heute kann man soziale und politische Rechte nur verbindlich einfordern, wenn sie nationalstaatlich verankert sind. Sie sagen, wir müssten für globale Commons – also Systeme der Gemeinnutzung und des Gemeineigentums – statt für den Wohlfahrtsstaat kämpfen. Wie soll das gehen?
Der Wohlfahrtsstaat wurde uns nicht geschenkt, sondern er wurde von unten erkämpft. Oder genauer gesagt: Die sozialen Rechte wurden erkämpft. Der Wohlfahrtsstaat war ein Befriedungsprojekt, um eine größere Veränderung zu verhindern. Anfang des 20. Jahrhunderts war das die Aussicht einer Weltrevolution. Mit dem Wohlfahrtsstaat wurden die globalen antikapitalistischen Bewegungen dann kooptiert. Wenn wir heute Rechte erkämpfen wollen, müssen wir solche antikapitalistischen Bewegungen wieder aufbauen. Und in diesem Sinn ist es Ziel meiner Arbeit, die Vorstellungshorizonte der Menschen zu ändern. Wir brauchen eine andere Wahrnehmung von uns selbst – nämlich nicht als Angehörige einer Nation oder rassifizierten Gruppe, sondern als Teil einer globalen Klasse. Das ist nicht dasselbe wie die liberale Idee des Kosmopolitismus. Es ist eine radikale Forderung nach Aufhebung der Spaltung. Nur auf Grundlage dieser Solidarität wird es uns gelingen, soziale Rechte zu verteidigen und zu erkämpfen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







