- Berlin
- Gesundheit
Suizidprävention in Berlin: Wenn Reden Leben rettet
Experten fordern bessere Aufklärung über Suizid-Warnzeichen
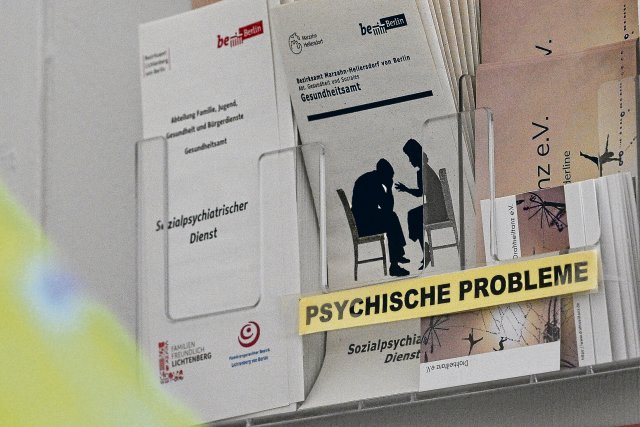
Die jahrelang gepflegte Briefmarkensammlung, Familienerbstücke, alte Fotoalben – beginnt jemand, solche persönlichen Gegenstände plötzlich und ohne erkennbaren Grund einfach an andere zu verschenken, sollten seine Angehörige besonders aufmerksam sein, raten Experten. Denn was wie eine nette Geste wirkt, ist in Wirklichkeit ein unheilvolles Omen: Die ungewöhnlichen Geschenke könnten darauf hinweisen, dass die betroffene Person mit dem Leben abgeschlossen und den Entschluss gefasst hat, Suizid zu begehen.
»Es gibt mehrere solcher Warnzeichen«, sagt Markus Geisler, Leiter der Fachstelle Suizidprävention am Montag vor dem Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. »Personen reden dann häufig darüber, eine Belastung zu sein oder keine Hoffnung mehr zu haben, oder sie ziehen sich zurück.« Doch häufig könnten Angehörige diese Zeichen nicht erkennen. »Die Betroffenen haben zwar indirekt über Suizidgedanken gesprochen, aber so chiffriert, dass es die Angehörigen nicht wahrnehmen konnten«, berichtet Geisler aus einer Befragung mit den Hinterbliebenen.
505 Menschen sind im vergangenen Jahr in Berlin durch Suizid gestorben, berichtet die Psychologin Birgit Wagner. »Das entspricht zwei Flugzeugabstürzen.« Unter jungen Menschen sei Suizid sogar eine der häufigsten Todesursachen. Bundesweit waren es 2024 10 304 Suizide – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber nur noch knapp die Hälfte des Niveaus von 1980. »Suizidprävention kann etwas bewirken«, sagt Wagner. Man könne empirisch nachweisen, dass politische Schritte die Suizidrate senken können.

nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik – aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin – ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.
Fast drei Viertel der Suizide werden von Männern begangen. Sie wählen öfter erfolgversprechendere Methoden der Selbsttötung und treffen die Entscheidung zum Suizid unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Zudem haben sie im Vergleich zu Frauen ein geringeres Bewusstsein für ihre psychische Gesundheit und sind weniger bereit, über ihren Gemütszustand zu reden. Das dürfte den paradox scheinenden Befund erklären, warum trotz des deutlichen Männerüberhangs bei vollendeten Suiziden 70 Prozent der Ratsuchenden bei den Beratungsstellen Frauen sind.
Für Markus Geisler ist der richtige Umgang mit den Warnzeichen ein Schlüssel, um die Zahl der Suizide zu reduzieren. »Es bedarf einer besseren Aufklärung für Angehörige, damit sie Veränderungen wahrnehmen können«, sagt er.
Doch dabei sollte es nicht bleiben, fordert Sibylle Löschber: Auch Fachkräfte wie Sozialarbeiter oder Lehrer müssten besser dabei unterstützt werden, Suizidalität zu erkennen, fordert die Leiterin der Beratungsstelle Neuhland, die sich besonders an junge Suizidgefährdete richtet. »Wir brauchen Lehrkräfte, die bereit sind hinzuschauen.« Die Fachkräfte müssten nicht nur Warnzeichen erkennen, sondern auch wissen, wie sie mit suizidalen Menschen umgehen und an wen sie sie weiterverweisen können.
Mit Sorge betrachtet Löschber, dass im Haushaltsentwurf die Mittel für Sozialarbeit an den Schulen drastisch gekürzt werden sollen. »Wir brauchen die Aufrechterhaltung der Schulsozialarbeit«, sagt sie. »Das sind häufig diejenigen, die als Erstes auf die Jugendlichen zugehen.«
Auch die Beratungsstellen selbst sind von Kürzungen im Haushaltsentwurf betroffen. »Wenn die Verstärkungsmittel im kommenden Haushalt nicht mehr zur Verfügung stehen, werden wir Sachen zurückbauen müssen«, sagt Benjamin Oche vom Berliner Krisendienst. In dieser Situation werde man Beratungspersonal abbauen müssen. Suizidgefährdete müssten dann länger auf Gespräche warten. »Für Menschen in akuten Krisen kann das tödliche Folgen haben«, sagt Oche.
»Menschen mit Suizidgedanken entwickeln einen Tunnelblick.«
Benjamin Oche Berliner Krisendienst
Prävention kann aber auch an einer anderen Stelle ansetzen: Mit Datenabgleichen könne man »Hotspots« identifizieren, an denen es besonders häufig zu Suiziden komme, bemerkt Markus Geisler von der Fachstelle. Dabei handele es sich etwa um frei zugängliche Hochhäuser oder Gleisanlagen. Dafür könnten Daten der Polizei und der Feuerwehr herangezogen werden, anschließend könnten bauliche Änderungen an diesen Suizid-Hotspots vorgenommen werden.
Doch das Vorhaben hat einen Haken: »Wir wissen nicht, was die Hotspots sind«, sagt Geisler. Denn bislang würden diese Daten nicht erfasst. Bislang habe es nur erste Gespräche mit der Polizei gegeben, um eine solche Datensammlung anzustoßen. Auch über versuchte Suizide lägen den Beratungsstellen keine Daten vor.
Ein solches Hotspot-Register ist Teil der Berliner Strategie Suizidprävention, die derzeit ausgearbeitet wird. Aktuell stimmten sich die Experten der Beratungsstellen ab, um der Senatsgesundheitsverwaltung einen Vorschlag vorzulegen, berichtet Geisler. Auch die Abstimmung zwischen Beratungsstellen, Krankenhäusern und therapeutischen Einrichtungen solle so gestärkt werden. Angelegt sei das Konzept auf zehn Jahre.
Sind die Suizidgefährdeten erst einmal in der Beratung angekommen, gibt es durchaus Hoffnung. »Menschen mit Suizidgedanken entwickeln einen Tunnelblick«, sagt Benjamin Oche vom Krisendienst. Die Selbsttötung erscheine den Betroffenen oft als einzige Lösung für ihre Probleme. Ein Gespräch helfe oft, neue Perspektiven zu entwickeln. »Viele Menschen, die in unsere Beratung kommen, sagen: ›Ich will nicht mehr leben.‹«, berichtet Oche. »Aber wenn man mit ihnen redet, findet man schnell heraus, dass eigentlich gemeint ist: ›Ich will so nicht mehr leben.‹«
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






