- Kultur
- Podcast
Podast »Der Bruch«: Wonder Woman Ost
Im Podcast »Der Bruch« erzählen ostdeutsche Frauen, wie ihnen der Mauerfall all ihre Superkräfte abverlangte

Am interessantesten am Osten waren die Frauen. Freizügig, ungezwungen, experimentierfreudig, so will es das West-Klischee. Gemeint ist aber etwas Anderes: Alltagsgeschichte oder Transformationsanalyse, in beiden Fällen sticht ein Untersuchungsgegenstand besonders hervor: die Ostfrau. Sie erscheint einem als wahnwitzige Gestalt, irgendwas zwischen achtarmiger Krake und Wonder Woman. Eine Überfrau, mit der Spezialkraft ausgestattet, Familie und Beruf gleichzeitig wuppen zu können. Die Realität war: Sie musste es wuppen können. Auch kein Mux der Überforderung; jahrzehntelang. Unabhängig war sie, stark, unkonventionell und risikobereit, wenn es sein musste, und extrem verantwortungsbewusst. Die Ostfrau, ein Mythos, der heute noch lebt. Spannend, ihn zu erforschen, zu befragen, noch aufregender nur, ist zuhören.
Mit Maxi Wander hat es angefangen, mit Torsten Körners Dokufilm »Die Unbeugsamen 2« über wichtige weibliche Persönlichkeiten des Ostens ging es weiter. Serien wie »Kleo« oder »Marzahn mon Amour« setzen den Ostfrauen ein amüsantes wie melancholisches Denkmal.
Ein weiterer, bemerkenswerter Beitrag, um sich dem Phänomen zu nähern, ist der Podcast »Der Bruch – Frauen zwischen Ost und jetzt«. Der Autorin der Sendung geht es darin nicht um besonders exponierte Frauen aus dem Osten, wie Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen oder Bürgerrechtlerinnen. Es sind die ganz normalen, die am Fahrradlenker nach der Arbeit fünf Einkaufstüten jonglieren und dabei nicht umkippen.
Genauso fehlt eine Geschichte vom Scheitern auf ganzer Linie. Anscheinend sind Ostfrauen dafür aber auch einfach nicht gemacht.
-
Am Anfang stellt sich aber noch die Frage: Woher kommt diese Faszination für die Ostfrau? Erste Indizien gab es ja vor Jahren schon, als man versuchte zu verstehen, warum der Osten so wütend ist. Die steile These damals: Dem Osten fehlen die Frauen. Die hätten nach dem Mauerfall schnell begriffen, dass das ganze Rumgejammere über den Verlust des Gewohnten auch keinem was nützt. Also gingen sie, suchten sich Jobs und Familien im Westen. Zurück blieb der frustrierte Ostmann. Und jetzt haben wir den Salat.
Als Teil der Wahrheit ist das sicherlich legitim. Aber genug schlaue Frauen sind auch geblieben. Was denken sie heute über jene Jahre, in denen nichts mehr war wie vorher? Wie haben sie sich durchgewurschtelt, was haben sie gehofft, wie sehr haben sie gezweifelt oder sind sie an der neuen Lebenssituation sogar gewachsen? Die Autorin und Journalistin Ruth-Maria Thomas, selbst erst 1993 in Cottbus geboren, hat eine Verbindung zum Thema durch ihre eigene Familie, kennt die Transformationsgeschichten ihrer Mutter und der zwei Großmütter. Für ihren Podcast hat sie bisher fünf Frauen interviewt. Eine ehemalige Kulturfunktionärin aus Wittstock (das ist aber auch schon die Privilegierteste von allen), eine Allgemeinärztin, eine LPG-Mitarbeiterin, eine Vertragsarbeiterin aus Vietnam und eine Frau aus einem VEB-Gummiwerk in Sachsen-Anhalt. Sie erzählen, wie sie die Zeit nach 1990 erlebt haben. Die Fragenstellerin Thomas hält sich dezent im Hintergrund, lässt die Frauen sehr ausführlich knapp 40 Minuten pro Folge erzählen. Allen gemein – und das muss ja aus der Umbrucherfahrung kommen – ist ihre Superpower, Rückschläge in Perspektiven umwandeln zu können. Jede der Frauen hat auf unterschiedliche Art den Verlust von Sicherheit und Gewissheit verarbeitet, keine hat resigniert (ganz im Gegensatz zu einigen ihrer Männer, um die es nur am Rande geht). Das verrät eigentlich nichts über die DDR, dafür viel über weibliche Resilienz.
Die größte Stärke des Podcasts ist, dass er die ganz individuellen Bewältigungsstrategien der Frauen zeigt, so wird auch dem, der die DDR nie selbst erlebt hat, klar, dass es »den Osten« nie gegeben haben kann. Es funktioniert auch nicht, eine Geschichte gegen die andere zu stellen oder sie zu hierarchisieren, ihnen ein kollektives Trauma (das schmutzige Wort heißt Sozialismus) zu unterstellen. Das ist für Ostsozialisierte natürlich überhaupt nichts Neues, aber zum Beispiel für Millennials aus dem Osten, die gerade erst anfangen, ihre Eltern über die DDR auszufragen, bereitet Thomas’ Podcast eine super Gesprächsgrundlage.
Besonders berührend ist die Folge von Hayk (es werden bei allen Frauen nur die Vornamen genannt), die als Allgemeinärztin arbeitete und ein überbordendes Maß an Verantwortungsbewusstsein besitzt, das sie letztendlich auch krank machen wird. Nach dem Mauerfall, da war sie noch sehr jung und Mutter kleiner Kinder, soll sie sich mit einer eigenen Praxis selbstständig machen. Sie kannte bisher nur die Poliklinik, schätzte den Kontakt zu Kolleg*innen, sie bekam ein festes Gehalt, es fühlte sich sicher und geborgen an, Ärztin zu sein. Dann kam der Cut, der Kapitalismus hält Einzug. Sie nimmt 60 000 Mark Schulden auf, um ihre Praxis zu finanzieren. »Mein Beruf war Ärztin und nicht Unternehmerin«, sagt sie. Die Umstellung auf Eigenverantwortung saugt das letzte bisschen Energie aus ihr heraus. Drei Monate nach der Eröffnung schließt sie ihre Praxis wieder. Sie wird auf der Straße als Versagerin beschimpft, die ihre Patient*innen im Stich gelassen habe. »Bei mir entstand ein Verarmungswahn, ich hatte massive Existenzängste.« Ihr ganzes Leben ist ein einziges Pflichtgefühl, erzählt Hayk. Sie muss also weiter funktionieren und eröffnet eine Gemeinschaftspraxis mit einer Kollegin. Am Wochenende klingeln die Patient*innen an ihrem Gartenzaun. Zehn Jahre später dann der massive Burn-out. Am Ende der Folge hört man ihre Tochter Birthe sprechen, die, man merkt es an ihrer Stimme, der Mutter bis heute nicht verzeihen kann, dass sie so abwesend war. Da fällt es schwer, keine Träne zu verdrücken, denn man weiß durch ihre Erzählungen, dass Hayk kurz vor dem Mauerfall den Plan hatte, weniger zu arbeiten, um mehr für ihre Kinder da zu sein.
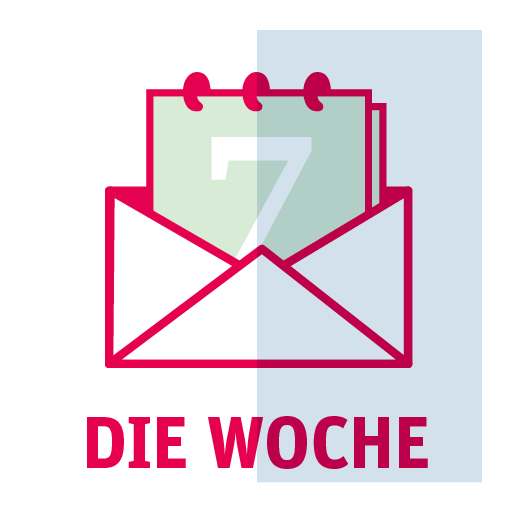
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Ganz anders ist die Geschichte von Brigitte, die »Karriere« in ihrem Gummiwerk in Sachsen-Anhalt machen sollte, als die DDR zusammenbrach. Ihr wird dann statt einer Leitungsposition angeboten, die Kantine des Betriebs in Abwicklung zu übernehmen. Sie sagt zu, aber die Kollegen kommen nicht mehr oder wurden entlassen. Im großen Essensraum wird es immer leerer und Brigitte hat auf einmal viel Platz. Ein Kollege bringt sie auf die Idee, eine Disco aus dem hinteren Teil des Speisesaals zu machen. Was als ziemlich spinnerte Idee beginnt, wird nur wenig später Sachsen-Anhalts größte Techno-Disco, das »Mirage«. Mit Hilfe eines Investors aus dem Westen wird Brigitte, die nie ihr Begrüßungsgeld abgeholt hatte und auch sonst »ein schönes Leben in der DDR« erwartete, die gerade noch Betriebsdirektorin eines Gummiwerks werden sollte, nun zur Party-Veranstalterin mit 100 000 Mark Umsatz in der Woche. Völlig irre die Geschichte, und das »Mirage« würde es heute noch geben, wäre es nicht vor fünf Jahren abgebrannt.
Ruth-Maria Thomas gelingt mit »Der Bruch« ein kleines Kunstwerk, das seine Protagonistinnen weder verklärt noch vorführt, das noch mal zeigt, welche unglaubliche Kraftanstrengung von den Menschen nach 1989 verlangt wurde, es ist ein Stück Oral History. Schade ist nur, dass (bis jetzt) keine Frauen vorkommen, die mit der DDR so gar nichts anfangen konnten oder zu der Mehrheit gehörten, die die D-Mark, ein neues Auto und Langstreckenflüge herbeisehnten – und zwar pronto subito. Eigentlich alle Frauen der Staffel hatten es sich in der DDR ganz gemütlich eingerichtet, das verengt natürlich ihre Sicht auf das, was danach kam. Ein anderer Blick auf den Transformationsprozess und das Ankommen im vielleicht einst so glorifizierten Westen wäre mindestens interessant. Genauso fehlt eine Geschichte vom Scheitern auf ganzer Linie. Anscheinend sind Ostfrauen dafür aber auch einfach nicht gemacht.
»Der Bruch – Frauen zwischen Ost und jetzt«, verfügbar in der ARD-Audiothek und allen gängigen Podcast-Plattformen
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.






