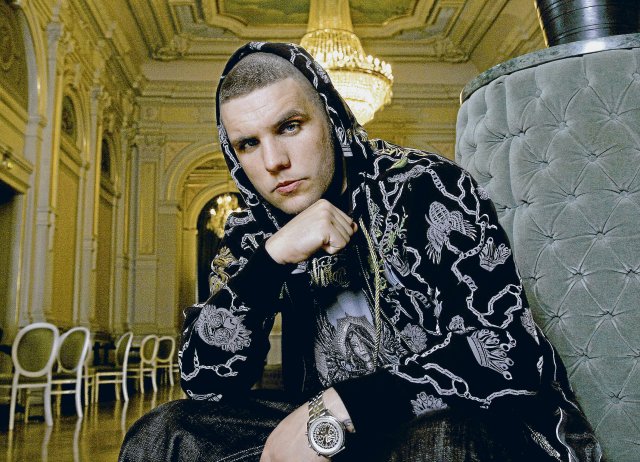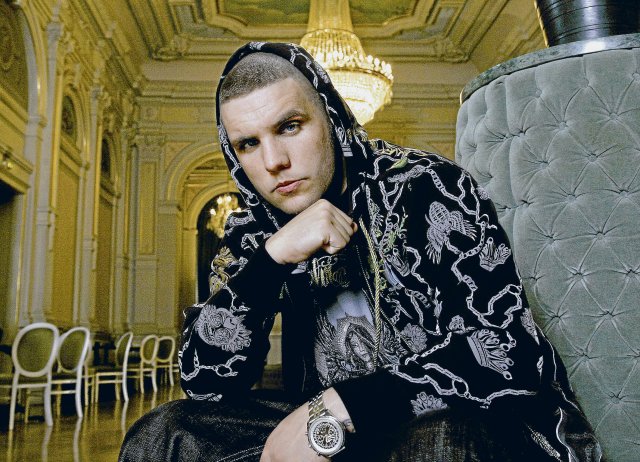- Kultur
- Akademie der Künste
Paul und Eslanda Robeson: Keine Identitätspolitik
Die Akademie der Künste zeigt Archivalien und Kunstwerke rund um das internationalistische Ehepaar Eslanda und Paul Robeson

Wen die Gewaltherrscher in die Knie gezwungen haben, dessen Erinnerung löschen sie aus. So geschah es Paul Robeson (1898–1976). Der Sänger, Schauspieler und Aktivist war der erste schwarze Superstar der Vereinigten Staaten. Seine Filme waren Kassenschlager, er sang vor Zehntausenden, als Othello trat er in Hunderten Theatervorstellungen auf. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg fiel er als Kommunist in Ungnade. Während er ins Vergessen getrieben worden ist, ist seine Frau, die Anthropologin Eslanda Goode Robeson (1895–1965), einem größeren Publikum kaum je bekannt gewesen und muss erst noch entdeckt werden. Es ist deshalb ein kluger Schachzug der Berliner Akademie der Künste, eine Ausstellung ausdrücklich dem Ehepaar Robeson zu widmen.
Die Kuratorinnen schöpfen aus dem Archiv, das die Akademie nach 1965 zu den Robesons angelegt hat. Die beiden, der Sowjetunion seit Langem eng verbunden, besuchten 1960 zum ersten Mal die DDR. Damals waren sie, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, Gebrochene, Kranke. Jahrzehntelang war Paul drangsaliert und gedemütigt worden, die Behörden hatten von 1950 bis 1958 die Pässe seiner Familie kassiert, das FBI verfolgte ihn ebenso wie ein aufgehetzter Mob. Nachdem Paul lange allen Anfeindungen getrotzt hatte, brach er schließlich doch zusammen. Wenige Monate nach seinem DDR-Aufenthalt beging er seinen ersten Selbstmordversuch und wurde unter anderem in Berlin-Buch gepflegt. Eslanda, genannt Essie, litt unter Krebs, dem sie wenige Jahre später erliegen sollte. An ihrer Trauerfeier konnte Paul schon nicht mehr teilnehmen.
Wie zu erwarten, distanziert sich die Akademie von der Sympathie der Robesons für die Sowjetunion, hat ihre Bedenken aber outgesourct.
Die Ausstellung gruppiert rund um die Archiv-Funde eine Reihe von künstlerischen Arbeiten. Ins Auge fallen Beiträge von Dread Scott, einem erfreulich militanten Künstler der USA, ein filmischer Brief an Eslanda von Katharina Warda, die als Tochter eines ANC-Aktivisten in der DDR geboren wurde, und eine Installation von Angela Ferreira, die unter anderem an die bezaubernde Postkartenaktion der DDR »1 Million Rosen für Angela Davis« (1970–72) erinnert.
Wie zu erwarten, distanziert sich die Akademie von der Sympathie der Robesons für die Sowjetunion, hat ihre Bedenken aber outgesourct: Das ukrainisch-polnische Künstlerpaar Lia Dostlieva und Andrii Dostliev setzt sich in ihrem Auftrag »kritisch mit den imperialen Narrativen der Sowjetunion und Russlands auseinander«, was zwar nicht unbedingt heißt, dass die Robesons auch an Putin schuld waren, jedoch die Kulturstiftung des Bundes als Hauptsponsorin erfreuen wird.
Unter uns gefragt: Wie kamen die beiden überhaupt nach Moskau? Antwort: Mit dem Zug, es war 1934. Bei einem Zwischenhalt in Berlin entging das Ehepaar nur knapp einem Trupp Braunhemden. Glücklich in der UdSSR angekommen, begrüßte sie der Regisseur Sergei Eisenstein, der gern mit Paul die Revolution von Haiti verfilmt hätte. Und so gastfreundlich ging es weiter. Mit dem Gelehrten W.E.B. Du Bois gesagt: Die Robesons liebten das Land, weil sie dort wie Menschen und nicht wie Hunde behandelt wurden.
Ohnehin scharte sich nahezu die komplette afroamerikanische Intelligenzija der USA um die Kommunistische Partei, die als einzige offen antirassistisch auftrat. Die kommunistischen Gewerkschaften, die es bis in die frühen Vierziger noch geben durfte, nahmen gern Schwarze und Latinos auf. Als Robeson gefragt wurde, wie er als reicher Filmstar dazu komme, sich für Arbeiter und Arbeiterinnen zu engagieren, erinnerte er daran, dass er sich sein Jurastudium mit miserabel bezahlten Jobs verdienen musste.
Der Historiker Mark D. Naison hält fest, außer vielleicht Woody Guthrie habe kein Exponent des US-Kulturlebens sich so wie Paul Robeson mit der Arbeiterschaft identifiziert – nicht nur mit derjenigen der USA. Bekannt ist seine enge Verbindung zu den walisischen Bergleuten; dieses Engagement spiegelt sich in dem Spielfilm »The Proud Valley« (1940). Er setzte sich aber auch vehement für die verfolgten Juden und die spanischen Republikaner ein.
Es verstünde die Robesons also völlig falsch, wer ihren Kampf auf Identitätspolitik verengen wollte. Anders als die Dichter der Négritude suchten sie nicht nach Vorfahren, sondern nach Mitkämpfern. Diesen Universalismus hat die Schriftstellerin Pearl S. Buck am besten verstanden, die über Eslanda Robeson schrieb, sie sei »nicht bloß ein Individuum. Sie erkennt sich in jedem Schwarzen, jeder Schwarzen in den Vereinigten Staaten wieder, in allen armen Weißen der Südstaaten, die Kopfsteuer entrichten, in allen Schwarzen – Mann, Frau oder Kind – in Afrika, in jedem und jeder Unberührbaren in Indien, in jedem und jeder Kolonisierten in Indonesien oder Indochina, in jeder Frau, die Gleichheit fordert.«
Ironischerweise trennte sich Eslanda von Paul, kurz nachdem sie ein sich trennendes Paar in einem kühnen Film gespielt hatten: »Borderline« (1930) von Kenneth Macpherson. Grund für den Ehestreit war ein Seitensprung Pauls, und als sie sich einige Jahre später wieder zusammenfanden, nahm, wie Eslandas Biografin Barbara Ransby bemerkt, ihre Verbindung Züge einer Geschäftsbeziehung und einer »Kamaradschaft« an. Eslanda, die bei Bronislaw Malinowski in London Anthropologie studiert hatte, reiste mit ihrem Sohn 1936 allein durch Afrika. Sie befreundete sich mit der Schwester von Jawaharlal Nehru, dem ersten Ministerpräsidenten Indiens, ebenso wie mit Janet Jagan, später erste Präsidentin von Guyana.
Während sich heutzutage alle gegenseitig darin übertreffen wollen, Grenzen zu ziehen, hielten die Internationalisten Eslanda und Paul Robeson nur eine einzige für erforderlich: die zum Faschismus. No pasarán! Alle anderen Grenzen von Ländern, Ethnien, Klassen, Kulturen überschritten sie lässig.
»Every Artist Must Take Sides. Resonanzen von Eslanda und Paul Robeson«, Akademie der Künste Berlin, noch bis 25. Januar.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.