- Wirtschaft und Umwelt
- WSI-Verteilungsbericht
Comeback der Jahrtausendwende
Der Verteilungsbericht des WSI zeigt: Einkommensungleichheit befindet sich auf einem neuen Höchststand

Es gibt eine Bilderstrecke aus einem »Calvin und Hobbes«-Comic – das sind Geschichten über einen kleinen Jungen in gestreiftem T-Shirt und seinen sprechenden Stofftiger, die Kritik am Zustand der Welt auf die Sprache eines Grundschülers herunterbrechen. In einer Bildfolge beschwert sich Calvin bei seinem Vater darüber, dass er nicht so lange wie seine Eltern wach bleiben darf – das sei ungerecht. Sein Vater erwidert: »Tja, die Welt ist ungerecht.« Und Calvin zieht grummelnd von dannen: »Ja, aber warum kann sie nie zu meinen Gunsten ungerecht sein?«
Dass Gerechtigkeit bis zu einem gewissen Punkt relativ ist, zeigt sich auch in Debatten über Vermögens- und Einkommensverteilung. Bis heute gibt es Kontroversen über das Ausmaß an Einkommensungleichheit – eigentlich erstaunlich, wie Dorothee Spannagel im neuen Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung schreibt. Das liegt unter anderem daran, dass Armut und Reichtum stets relativ zum Einkommen einer Gesellschaft gemessen werden – also abhängig vom Maßstab der gesellschaftlichen Gesamtsituation sind.
Haushalte in Armut sind heutzutage jene, die unterhalb von 60 Prozent des mittleren Median-Einkommens liegen. Das entspricht einem jährlichen Nettoeinkommen von weniger als 15 439 Euro, nach Abrechnung von Steuern und Abgaben und Hinzurechnung von Transfers. Demgegenüber stehen einkommensreiche Haushalte mit über 200 Prozent des Medianeinkommens, etwa 51 500 Euro netto. Die Einkommensungleichheit befindet sich, wie Spannagels Bericht bestätigt, derzeit auf einem Höchststand. Während Armut gewachsen ist, hält sich Reichtum stabil und die untere Mitte der Gesellschaft sinkt langsam in die Armut ab.
»Der jetzige Zustand widerspricht jeglichem Gerechtigkeitsempfinden.«
Dorothee Spannagel WSI
Die Ungleichverteilung ist auch während der wirtschaftlich starken Dekade der 2010er gestiegen. Das liegt daran, dass gewisse Bevölkerungsgruppen nicht vom damaligen Aufstieg profitiert haben. Der gesetzliche Mindestlohn, den die Große Koalition 2015 einführte, erzeugte starke Einkommenssteigerungen. Diese erreichten jedoch Menschen außerhalb des Arbeitsmarkts nicht. Staatliche Transferleistungen wie die Rente ließen in jenen Jahren nach und die Grundsicherung blieb hinter den Löhnen zurück. Nach 2018 beschleunigte die sogenannte Polykrise, zu der gemeinhin Covid-19, das Klima und bewaffnete Konflikte zählen, diese Entwicklung. Das Einkommen Reicher scheint dagegen durch die Krisen nicht beeinflusst worden zu sein.
Besonders sprunghaft stiegen die Armuts- und Reichtumsquoten und damit die Ungleichheit um die Jahrtausendwende. Durch die Hartz-4-Reform wuchs der Niedriglohnsektor, die Arbeitslosigkeit befand sich auf einem hohen Niveau und der technologische Wandel förderte die Lohnspreizung. Dazu kam die Senkung des Spitzensteuersatzes. Spätestens bei dieser Aufzählung klingeln mit Blick auf die heutige Situation einige Alarmglocken.
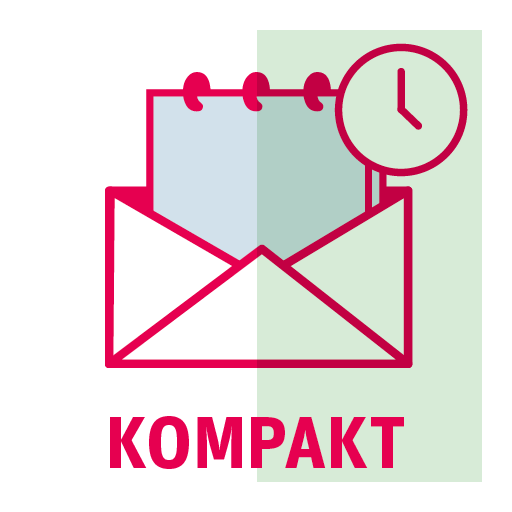
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Bundesregierung aus Union und SPD plant mit der Umwandlung des Bürgergelds in die neue Grundsicherung unter anderem den Vermittlungsvorrang wieder einzuführen. Dieser sollte während der Hartz-4-Zeit Personen besonders zügig in Erwerbsarbeit überführen, bevor Weiterbildungen, Umschulungen oder ein Existenzgründungszuschuss gezahlt wurden. Beschäftigung soll in der neuen Grundsicherung notfalls auch durch Totalsanktionen, also vollständige Leistungskürzungen, erzwungen werden.
»Es lässt sich zeigen, dass der Vorrang der möglichst zügigen Integration auf den Arbeitsmarkt gegenüber etwa einer Weiterqualifizierung und einer langfristigen Arbeitsmarktintegration negative Folgen hat«, erklärt Spannagel auf nd-Nachfrage. Bei Hartz 4 kam es zu sogenannten Drehtüreffekten, durch die Menschen kurz erwerbstätig und dann wieder arbeitslos waren. Schlechte Bezahlung führte dazu, dass Personen ihr Gehalt über Sozialleistungen aufstocken mussten und die Anzahl der Personen mit Einkommen unterhalb der Armutsgrenze stieg. »Die Folgen dürften dieses Mal dieselben sein«, resümiert Spannagel.
Ein weiteres Ergebnis ihrer Studie: Je geringer das Einkommen, desto geringer das Vertrauen in demokratische Institutionen. Das zeigt sich auch bei den jüngsten Wahlen. Über sieben Prozent der Armen gingen trotz einer stark gestiegenen Wahlbeteiligung 2025 nicht zu den Urnen, um über die nächste Besetzung des Bundestags zu entscheiden. Unter den Reichen war es ein Prozent. Die Wahlbeteiligung der Armen stieg dennoch im Vergleich zu 2021 stark, davon profitierte vor allem die AfD. »Wenn Menschen in Armut die Erfahrung machen, dass Arbeitsmarkt und Sozialstaat ihr Versprechen nicht einlösen, destabilisiert das die Gesellschaft als Ganzes«, schließt die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch, aus den Studienergebnissen.
Um dieser Entwicklung vorzubeugen, schlägt Spannagel vor, »gute Erwerbsarbeit« zu stärken. Das sei ein sicherer Arbeitsplatz mit guter Bezahlung. »Wann, wenn nicht in Zeiten sehr niedriger Arbeitslosigkeit und sehr hohen Arbeitskräftemangels, soll es möglich sein, gute, tarifgebundene und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen?«
Darüber hinaus müssten Familie und Beruf vereinbarer gemacht werden und Teilhabe durch angemessene Transferleistungen ermöglicht werden. Dazu kommt der Dauerbrenner – eine höhere und lückenlose Besteuerung höchster Einkommen und Vermögen. »Der jetzige Zustand widerspricht jeglichem Gerechtigkeitsempfinden«, kritisiert Spannagel.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.






